
Botswana, 1993
Die Fahne wurde anlässlich einer Konsultation der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) in Botswana 1993 entworfen. Sie zeigt neben dem schlichten Kreuz am linken Rand einen Kreis, in dem zwei Piktogramme das gemeinsame Lernen/Beten/Diskutieren und das zusammen Arbeiten bzw. das gemeinsam In-die-Tat-Umsetzen veranschaulichen sollen. Die Piktogramme umrahmen wiederum den Namen eines kirchlichen Trainigszentrums. In der rechten oberen Ecke sind die aus verschiedenfarbigen untereinander gestellten Bändern gebildeten Buchstaben „U“ und „M“ zu sehen, die als Akronym für den programmatischen Prozess der Konsultation, United in Mission, stehen. Schräg darunter verläuft ein Band in den Nationalfarben Botswanas. Im unteren Drittel läuft über nahezu die gesamte Breite der Fahne ein Schriftzug, der auf Ort, Monat und Jahr der Veranstaltung hinweist.
Das Lehr- und Schulungszentrum der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Botswana (ELCB) befand sich in Ramatea, im Nordosten Botswanas. Im Jahr 1993 war es Veranstaltungsort in einer langen Reihe von Konsultationen an verschiedenen Orten in Afrika, Asien und Deutschland. Der über mehr als 10 Jahre dauernde Prozess führte zu einer strukturellen und auf einer weiteren Konsultation in Bethel bei Bielefeld 1996 schließlich auch formal beschlossenen Internationalisierung der VEM. In Ramatea wurden die wesentlichen Voraussetzungen für diesen Schritt geschaffen. Er bedeutete nicht weniger als die Umwandlung des ehemals deutschen Missionswerks unter rein deutscher Leitung in eine sich heute als internationale Gemeinschaft von Kirchen in drei Erdteilen verstehende Organisation.
Batak-Region, Sumatra, Niederländisch Indien / Indonesien, 1914
„Alljährlich wird in Sipholon, das ungefähr im Mittelpunkt des Bataklandes liegt, die große Hauptkonferenz abgehalten und zwar in der Zeit, wenn die Seminarschüler ihre großen Ferien haben.“ So liest es sich in der Bildbeschreibung des Bildes Nr. 70, das Teil eines Lichtbildvortrages des Missionars der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) Emil Becker aus den 1920er Jahren ist.
Eigentlich handelte es sich bei dem dort in Bild und Text festgehaltenen Ereignis um eine sogenannte Regionalkonferenz, wie sie in jedem der ehemaligen Missionsgebiete der RMG in Afrika und Asien abgehalten wurde. Nach Möglichkeit sollten alle in dem entsprechenden Gebiet tätigen rheinischen Missionare an der Tagung teilnehmen, um sich über den aktuellen Stand der Dinge direkt austauschen und gemeinsam übergreifende Fragen oder Probleme mit Klärungsbedarf an die Leitung der Gesellschaft in Deutschland übermitteln zu können.
Glaubt man der Beschreibung, war es darüber hinaus für die Teilnehmenden „eine Zeit innerlichster Erquickung und vielseitigster Anregung, ein wahrer Höhepunkt im Missionsleben draußen!“, zumal sich „manche […] ja ein ganzes Jahr nicht gesehen“ hatten. Dass eine Teilnahme an den Treffen im 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts nicht unbedingt selbstverständlich war, wird schließlich in dem folgenden Zitat deutlich: „In der früheren Zeit, als die Wege noch wenig ausgebaut waren, hatten manche Missionare 6 – 8 Tage nach Sipholon zu reisen.“
Für die Anreise zu einer Konsultation der Nachfolgeorganisation der RMG in Botswana nahezu 80 Jahre später(siehe aktuelles Objekt des Monats), dürften die Kirchenvertreterinnen und -vertreter aus Sumatra etwa zwei bis drei Tage gebraucht haben. Doch nicht nur die Reisezeiten und -modalitäten hatten sich bis zu diesem Zeitpunkt erheblich verändert. Auch die institutionellen Strukturen hatten sich von einer patriarchal organisierten Missionsgesellschaft hin zu einer Organisation entwickelt, die nach einem gleichberechtigten Umgang ihrer Mitglieder untereinander und als Glieder einer internationalen Gemeinschaft suchte.
Bei dem sorgfältig bearbeiteten Horn von einem Rind oder Büffel handelt es sich um ein akustisches Signalinstrument. Es wird über die seitlich angebrachte, in Rombusform gearbeitete Öffnung angeblasen, sodass sich das Instrument auch als Querhorn bezeichnen lässt.
Genutzt wurde das etwa 50 Zentimeter lange Horn zur Verständigung über weitere Entfernungen hinweg. Es stammt aus der im Nordwesten des Kongo gelegenen Region Equateur und wurde vermutlich in dem Ort Mondombe am Fluß Tshuapa hergestellt und in den dortigen Wäldern für die Jagd genutzt.
Die um den Rand des Trichters als Schmuck gewickelte Echsenhaut, die handwerklich hochwertige Bearbeitung auf Höhe des Mundstücks und die glänzende Patina verweisen jedoch darauf, dass es sich bei dem Instrument um mehr als nur einen Alltagsgegenstand handelt. Vielmehr ist es ein Prestigeobjekt, das von seinen Besitzern sorgfältig gepflegt wurde und auch deren Status in der Gemeinschaft anzeigen mochte.
Das Horn wurde Pastor Eliki Bonanga, heute Präsident der Communauté des Disciples du Christ au Congo (CDCC), von seinem Vater vermacht. Als Geschenk an den damaligen Referenten der Abteilung für das frankophone Afrika der VEM gelangte das Instrument 1987 nach Wuppertal und ist seither Teil der Sammlung der Archiv-und Museumsstiftung der VEM.
Damit steht das Objekt auch für ein Stück Missionsgeschichte und Institutionsgeschichte, indem es eine Brücke schlägt von der Zeit vor der Entstehung einer christlichen Kirche in dieser Region des Kongo bis in die Gegenwart ihrer Mitgliedschaft in einer internationalen Gemeinschaft von Kirchen, als die sich die VEM heute versteht.
Das Bild zeigt ausgedehnte Reisfelder in einer Ebene im zentralen Teil Sumatras Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Anbau von Nassreis war und ist von der Anzucht der Setzlinge über die Vorbereitung der Parzellen, das Setzen und Hegen der Jungpflanzen bis zur Ernte und Verarbeitung aufwendig, arbeitsintensiv und – insbesondere wenn es ohne Hilfe von Maschinen geschieht – teilweise mit Schwerarbeit verbunden.
Zu sehen sind die Arbeiten, die etwa zwei Monate nach dem Setzen der Jungpflanzen durchgeführt werden müssen, um den Bewuchs mit Unkraut einzudämmen und überall dort nochmals junge Pflanzen einzusetzen, wo nach dem ersten Setzen Lücken entstanden sind. Solche Arbeiten müssen nahezu durchgängig in gebückter Haltung und sich durch den schlammigen Grund fortbewegend durchgeführt werden. Dies ist kräftezehrend, zumal unter klimatischen Verhältnissen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, wie sie für die Anbaugebiete in Asien die Regel sind. Es waren ausschließlich Frauen, die diese Arbeiten übernahmen, wie auf dem Foto deutlich zu erkennen ist.
Der Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) Emil Becker kommentierte ein Hilfsmittel bei dieser Arbeit: „… zum Schutz gegen Regen tragen sie einen ‚Rückenschirm‘, der aus Palmblättern geflochten ist. Gar drollig ist der Anblick dieser ‚wandelnden Dächer‘, unter denen der Uneingeweihte wohl nicht so leicht arbeitende Frauen vermuten wird.“ Seine Beschreibung des aus europäischer Perspektive Ungewohnten bzw. „Anderen“ der Szene mutet aus heutiger Perspektive befremdlich an.
Sein Kommentar mag damit jedoch umso mehr auf die Verwendung des Bildes im Rahmen der damaligen Öffentlichkeitsarbeit der RMG gegenüber ihren Unterstützerkreisen in Deutschland verweisen. Denn die Szene ist als Abbildung Nr. 14 mit der begleitenden Beschreibung Teil eines Lichtbildvortrags über das ostasiatische Missionsgebiet. Mitarbeiter der RMG nutzten ihn bei Veranstaltungen u.a. in Gemeindehäusern und Schulen, um Spenden ein- und neue Kandidaten und Kandidatinnen für den Missionsdienst anzuwerben.
1896 empfingen sieben junge Brüder die Weihe zum Predigtamt. Sechs von ihnen hatten ihre Ausbildung im Missionshaus erhalten und nach Absolvierung des sechsjährigen Lehrgangs am 27. Juli die Abgangsprüfung bestanden. Unter ihnen befand sich auch Friedrich Diehl aus Ehringshausen bei Wetzlar. Zusammen mit dem Theologen Franz Zahn wurde Diehl noch im selben Jahr nach China entsandt, wo er zunächst bis 1904 in Thongthauha stationiert war. Bis 1934 arbeitete er außerdem in Tungkun (Dongguang) Taiping und Hongkong.
Während seiner Zeit in China sah er sich regelmäßig beim Erlernen der Sprache und durch die sozio-kulturell bedingt anderen Umgangsformen gefordert. 1911 sollte ein Lichtbildabend veranstaltet werden, um die Neugier seiner Gemeinde auf biblische Bilder zu befriedigen, wie er meinte. Diehl hoffte, im Zuge dieses Abends auch gleich das Evangelium predigen zu können. Doch er wurde bitter enttäuscht als das Publikum zwar fasziniert von den Abbildungen war, doch lautstark verlangte, er solle doch aufhören die Bilder zu erklären. Erst durch die Einschaltung der örtlichen Polizei und durch den einsetzenden Regen ließ sich die unzufriedene Menschenmenge auflösen.
Auch berichtet Diehl immer wieder von Räuberbanden, die ganze Häuser plünderten und den Geschädigten nichts als die Kleidung am Leib ließen. Selbst wurde Diehl mehrfach Opfer von Überfällen. 1897 und 1905 wurde er jeweils von Flussräubern überrascht, die Boote und Schiffe stürmten, um Bargeld und Wertsachen zu erbeuten. Diehl blieb, anders als der mitreisende Missionar Linden, der 1905 durch einen Beinschuss verwundet wurde, in beiden Fällen unverletzt.
Von solchen Vorfällen ließ sich Diehl nicht entmutigen. Er schrieb: „Daß unter diesen höchst zweifelhaften Zuständen unsere Arbeit trotzdem von Segen begleitet ist, beugt uns tief in den Staub und hilft uns festhalten an der frohen Hoffnung: […] Gottes Pläne werden auch in China noch einmal verwirklicht werden.“
Diehls Optimismus und Ideenreichtum spiegelt sich auch in seinem hier abgebildeten Gesangbuch wider. Um die linguistischen Differenzen zu überwinden, ging er dazu über, die Liturgie phonetisch zu transkribieren, um die deutschen Melodien und Betonungen in das Chinesische zu übertragen. Vermutlich konnte er so als Vorsänger den Gottesdienst leiten und die formale westliche Lied- und Gebetspraxis in bzw. trotz der anderen Sprache erhalten.
Die Aufnahme zeigt das Bergpanorama am südlichen Ufer des Kivusees. Die Perspektive lässt hauptsächlich den Blick auf die Hänge im Vordergrund sowie die Bergketten im Nordwesten zu, die am anderen Ufer aufragen. Von der Wasserfläche selbst ist nicht viel zu erkennen, wohl aber kleinere Inseln, die vor der Mündung des Flusses liegen, der wiederum im Tal unterhalb des Standortes des Fotografen Richtung See fließt. Im Vordergrund sind vier Männer zu sehen, die – sich teils auf ihre Hirtenstäbe stützend – auf dem Hang zu verweilen scheinen.
Bis zum ersten Weltkrieg verlief durch den See die Grenze zwischen den Einflusssphären zweier Kolonialmächte, dem belgisch beanspruchten Kongogebiet und dem vom deutschen Reich beanspruchten Ruanda als Teil seiner Kolonie in Ostafrika. Auf dessen Gebiet befand sich nicht nur der Fotograf zum Zeitpunkt der Aufnahme, auch die Evangelische Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika (später in Bethel Mission umbenannt) hatte dort seit 1907 ihr Missionsgebiet. Vor und auch noch während der deutschen Kolonialzeit, war es jedoch der König von Ruanda, Yuhi V. Musinga, der durch geschicktes Agieren den Kolonialbeamten wie den Missionaren gegenüber die Souveränität über sein Reich und seine Untertanen praktisch behielt. Diese verlor er erst, nachdem belgische Truppen das Territorium eroberten und den König später ins Exil zwangen.
So kann die idyllische Landschaftsaufnahme auf den zweiten Blick auch als eine geostrategische Bestandsaufnahme gedeutet werden, die auf die Ambitionen europäischer Mächte auf dem Höhepunkt ihrer territorialen Expansion in Afrika verweist.
Auch in der Gegenwart bildet der See eine Staatsgrenze. Durch seine Mitte verläuft die Grenze zwischen der DR Kongo und Ruanda, die wiederum im Spannungsfeld einer der andauernden Krisen des Kontinents auch im 21. Jahrhundert liegt.
Das Essstäbchen kann wohl mit einiger Berechtigung als Synonym für die Esskultur Ostasiens schlechthin stehen. Denn mit Ausnahme der Suppe isst man in China, Korea, Japan und Teilen Südostasiens alle Speisen praktisch ausschließlich mit diesem Besteck.
Die hier gezeigten Stäbchen erscheinen auf den ersten Blick schlicht, was ihre Beschaffenheit und das Material betrifft. Das standardmäßig aus Bambus gefertigte Besteck zeugt auf den zweiten Blick jedoch von sehr guter handwerklicher Qualität: Die Stäbchen sind kreisrund und glatt gearbeitet und am oberen Ende mit je einer Metallkappe versehen, die mit einer Zwinge fest im Bambus verankert wurde. Sie sind darüber hinaus so lasiert, dass sich eine Marmorierung ergibt, die an die Struktur und Maserung von Edelhölzern denken lässt.
Mit 26 Zentimetern haben die Stäbchen die in China verwendete Standardlänge. Damit sind sie im Vergleich zu ihrem japanischen Pendant länger. Während dort das Essen traditionell jeweils individuell am Platz gereicht wird, werden die Speisen in China in der Mitte der mehr oder weniger großen und oft runden Tafel arrangiert, und die Essenden bedienen sich selbst aus den oft zahlreichen verschiedenen Speisen. Diese Variante erfordert eine ausreichende Länge des Essbestecks, um sich bequem über die Tafel hinweg aus Schalen und von Tellern und Platten bedienen zu können.
Die Aufnahme wurde vermutlich in einer Stadt der heutigen Provinz Guandong (evtl. in Guangzhou oder auch in Honkong) gemacht. Zu sehen ist eine kleine Menschenansammlung vor einem Hauseingang, die offenbar für den Fotografen posiert. Die linke Bildhälfte nimmt ein provisorischer Tisch oder eine Kommode ein auf der sich eine Kombination aus Klappkästen und Schubfächern befindet. Auf den Innenseiten der Klappkästendeckel sind Schriftzeichen zu sehen, in den Kästen selbst scheinen einige Gegenstände einer bestimmten Ordnung zu gehorchen. Der Besitzer der Kästen dürfte der Mann mit Hut und im hellen Hemd sein, der hinter dem Arrangement sitzt und in die Kamera schaut. Welche Ware oder Dienstleistung er anbietet, ist aufgrund der Lichtverhältnisse und der Bildqualität nicht ersichtlich.
Das eigentliche Motiv des Fotografen befindet sich jedoch in der Mitte der Aufnahme bzw. hängt von einer Art kunstvoll geschmiedeten Bügel vor der kleinen Menschenansammlung herab, der wiederum an einer in die Hauswand eingelassenen Stange befestigt ist. Es handelt sich dabei um eine dekorativ in fünf Bögen drapierte Girlande, deren Material ebenfalls aufgrund der Bildqualität bestenfalls zu erahnen ist. Die überlieferte Bildbeschreibung klärt jedoch auf, dass hier ein Zahnarzt seine Arbeit anhand der erfolgreich gezogenen Zähne seiner Patienten und Patientinnen bewirbt, die auf eine Schnur gezogen in dem Arrangement präsentiert werden.
In der Region westlich des Victoriasees spielte und spielt Viehhaltung eine wichtige Rolle für den Lebensunterhalt der Menschen im ländlichen Raum. Neben Fleisch und Häuten ist das mit Abstand wichtigste Produkt aus der Haltung von Kühen und in geringerem Maße auch von Ziegen die Milch. Formschön gearbeitete Behälter wie der hier zu sehende wurden bei der ansässigen Bevölkerung der Haya für die Aufbewahrung des Nahrungsmittels genutzt. Für den vorgesehenen Zweck handelt es sich mit einer Höhe von gut 25 cm und einem Durchmesser von gut 10 cm um einen Behälter mittlerer Größe. Das kleinste Gefäß dieser Art in der Sammlung der Archiv- und Museumsstiftung der VEM hat etwa die Größe eines Trinkbechers. Das Limit für große Behälter wurde letztlich durch das Volumen von verfügbarem Stammholz bestimmt.
Das Besondere an diesem Behälter ist, dass sich ablesen lässt, welch hohen Wert für den Haushalt ihm beigemessen wurde. Er wird durch die Reparatur der durchlaufenden Sprünge im Holz durch Eisenverklammerungen deutlich. Das Verfahren war aufwendig und wäre wohl nicht angewandt worden, wenn man den Behälter problemlos gegen einen neu angefertigten hätte austauschen können.
Auch für die Herero im heutigen Namibia war die Züchtung und Haltung von Vieh von großer Bedeutung. Ziegen und Rinder waren nicht nur Lieferanten von Milch für den alltäglichen Gebrauch und Fleisch für besondere und festliche Anlässe. Rinder bzw. deren Besitz waren vielmehr auch ein zentraler Bestandteil des gesellschaftlichen und kulturellen Selbstverständnisses.
Ein weiteres wichtiges Produkt aus der Viehhaltung waren die Häute der Tiere, die in der Regel – und je nach Bedarf mit oder ohne Fell – gegerbt und zum weiteren Gebrauch verarbeitet wurden.
Das Bild zeigt sechs Frauen, die auf dem Boden sitzend oder kniend solche Felle bearbeiten. Der Größe der Felle nach zu urteilen, dürfte es sich zumindest zum Teil um solche von Rindern handeln. Während die vier sitzenden Frauen offensichtlich einzelne Häute zu größeren Decken oder auch Abdeckungen vernähen, ist aufgrund der Qualität des Fotos nicht eindeutig zu erkennen, um welchen Bearbeitungsschritt sich die beiden Frauen im rechten Bildteil kümmern. Es erscheint aber gut möglich, dass sie die vor sich ausgebreitete Haut mit einem Schaber bearbeiten, um gegebenenfalls das Fellkleid oder dessen Reste zu entfernen. Die abgebildeten Frauen tragen die typische Kleidung der Zeit wie sie jedoch auch heute noch von vielen Angehörigen der Bevölkerungsgruppe, v.a. auch zu festlichen Anlässen, mit Stolz getragen wird.
Zwar ist nicht bekannt, wann die Aufnahme entstanden ist, doch es handelt sich um einen der nicht allzu häufigen Fälle, in denen der Ort der Entstehung überliefert ist. Sesfontein liegt in der heutigen Verwaltungsregion Kunene, deren südlicher Teil auch damals bereits zu den überwiegend trockenen Landesteilen gehörte in welchen Regenfeldbau kaum möglich war. Mit der extensiven Viehwirtschaft und einer halbnomadischen Lebensweise hatten die Herero die wohl am besten an das Klima und die Umweltbedingungen angepasste Lebensweise in dieser Region praktiziert.
Die Suona zeichnet sich bautechnisch durch ein Doppelrohrblatt aus, das im Inneren der konisch gearbeiteten Röhre aus Holz unterhalb des Mundstücks eingesetzt ist. Damit gehört das Instrument zu den Oboen, auch wenn es mit seinem Mundstück und dem abnehmbaren Trichter aus Messing äußerlich seiner europäischen Schwester nur wenig ähnlich scheint.
Die Suona ist fester Bestandteil traditioneller Volksmusikensembles, den sogenannten Guchui. Zusammen mit Trommeln, Gongs und anderen Instrumenten wird sie insbesondere gerne bei Hochzeiten gespielt und ist durch ihren hohen, durchdringenden und zuweilen etwas schrillen Ton charakterisiert.
Zwar hat das Spiel auf der Suona in China schon eine lange zurückreichende Tradition, doch ursprünglich kommt das Instrument wohl aus Persien. Über Zentralasien fand es seinen Weg nach China und bis weit darüber hinaus auch auf die koreanische Halbinsel, nach Indien und Südostasien. Auch an der ostafrikanischen Suaheliküste hat eine Variante des Instruments ihren festen Platz in den Musikensembles – z.B. auf Sansibar oder Lamu – gefunden. Hier ist neben der schlanken Röhre mit dem charakteristischen Doppelrohrblatt oft jedoch auch der Trichter aus Holz gefertigt. Die Tonlage ähnelt dennoch jener der Suona. Auch einige Oboen von der Suaheliküste befinden sich in der Sammlung der Archiv- und Museumsstiftung der VEM.

Das Foto zeigt eine sommerliche Szene. Die Betrachterin oder der Betrachter schaut in die Tiefe einer Streuobstwiese. Im Vordergrund sind im Zwielicht der schattenspendenden Obstbäume Jungen und Männer zu sehen, die auf leichten Klapphockern sitzend ihre Blechblasinstrumente spielen. Die Kleidung der Musikanten verrät einerseits den festtäglich und vermutlich auch sonntäglichen Anlass des Konzerts unter freiem Himmel, ihre sprichwörtliche Hemdsärmeligkeit aber gleichfalls die sommerliche Wärme des Tages. Dennoch trägt der junge Mann am linken Bildrand seine Krawatte, und dirigiert die Bläser mit ernstem Gesichtsausdruck. Drei weitere Männer sitzen, die Jacken ihrer Anzüge neben sich liegend, die Ärmel ihrer hellen Hemden hochgekrempelt am vorderen rechten Rand des Bildes und unterstreichen mit ihrer entspannten, ja lässigen Haltung die scheinbare Leichtigkeit der Szene. Das weit über hundert Personen zählende Publikum sitzt im Hintergrund und ebenfalls im Schatten der Obstbäume auf der leicht ansteigenden Wiese und vermutlich auf ähnlichen Sitzgelegenheiten wie die Musikanten. Auch die Zuhörenden sind sonntäglich, aber auch sommerlich leicht gekleidet. Hüte und Schirme bieten einigen unter ihnen zusätzlichen Schutz vor der Sonne.
So unbeschwert und zufällig die Szene wirkt, so bedacht scheint der Ausschnitt gewählt und das Bild komponiert. Denn es fängt nicht nur die Atmosphäre an diesem Tag sehr gut ein, sondern dokumentiert eine Veranstaltung, die für Organisationen wie die Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) eine wichtige Bedeutung hatte. Missionsfeste dieser Art, ob um Ostern herum, im Sommer oder auch in der Vorweihnachtszeit, waren fester Bestandteil im Jahreskalender der Missionsgesellschaften. Hier versicherte man sich der Gemeinschaft von Mitarbeitenden am Heimatstandort der Gesellschaft, den von ihr in die damaligen Missionsgebiete Entsandten und deren Gemeinden sowie den Mitgliedern der die Mission ideell und finanziell unterstützenden Kirchengemeinden in der Region und darüber hinaus. Neben den Ansprachen von Funktionsträgern aus Kirchen und Missionsgesellschaft, den Berichten von entsandten Männern und Frauen, die sich gerade im Heimaturlaub befanden und dem gemeinsamen Beten, hatte immer auch die Musik ihren Platz auf solchen Veranstaltungen. Und in der Regel war es auch in den ersten Jahrzehnten nach dem zweiten Weltkrieg der klassische Posaunenchor, der die Feste musikalisch begleitete.

Das Tabakrauchen oder -kauen war und ist neben dem Konsum von alkoholhaltigen Getränken die wohl weltweit am weitesten verbreitete Form des Rauschmittelkonsums. Dem trägt die Wertschätzung Rechnung, die dem getrockneten Blatt der Tabakpflanze nicotiana in vielen kulturellen und sozialen Kontexten zukommt. Die ursprünglichen Verbreitungsgebiete der Pflanzengattung finden sich auf dem amerikanischen Kontinent, in Australien, Teilen Ozeaniens und Afrikas (siehe dazu auch Bild des Monats).
Die hier zu sehende, knapp 25 Zentimeter lange und zu ihrem hinteren Ende leicht konisch zusammenlaufende Tabakrolle stammt aus dem Hochland von West Papua. Die fein gerollten Tabakblätter sind in einer Tasche aus getrockneten, harten und widerstandsfähigen Blättern aufbewahrt, die schließlich noch einmal mit einem Band aus dunklerem Bast umwickelt sind. Oft werden Bambusblätter für diese Art der Verpackung genutzt. Letztere verweist auch auf den Wert, der ihrem Inhalt beigemessen wird. Denn die Rollen dienten nicht nur dem alltäglichen Transport für den gelegentlichen Eigenbedarf. Sie waren vielmehr auch eine handelsübliche Einheit für eine Vermarktung über größere Entfernungen. Der Tabak wie auch die im Tausch dagegen gehandelten Produkte mussten in der Regel auf oft mehrere Tage andauernden Fußmärschen zwischen Bergregion, Tälern und Küste transportiert werden, um ihren Besitzer zu wechseln.
Auch auf dem afrikanischen Kontinent kommt eine Wildform der Tabakpflanze, Nicotiana africana, vor. Es handelt sich jedoch nicht um eine auf dem Kontinent für den Eigenbedarf oder kommerziell angebaute Art, da sie nur als Wildpflanze in der Namib zu finden ist und erst Mitte der 1970er Jahre wissenschaftlich beschrieben wurde.
Der Tabakanbau in Afrika ist dagegen eine spätere Folge des in der frühen Neuzeit aufkommenden, global vernetzten Warenhandels. Mit ihm gelangte der Tabak als Genuss- und Rauschmittel von Amerika über Europa auch nach Afrika.
Das undatierte und kaum näher beschriebene Foto aus den Beständen der Bethel Mission zeigt eine kleine Pflanzung vor einem strohgedeckten Haus im heutigen Tansania. Die Aufnahme könnte sowohl bereits zur Zeit der deutschen Kolonialherrschaft über das Gebiet als auch erst in der englischen Protektoratszeit gemacht worden sein. Wahrscheinlich handelte es sich in diesem Fall um eine Pflanzung, die von lokalen Bauern für den eigenen Bedarf oder auch eine lokale Vermarktung in der Umgebung angelegt worden war. Der kommerzielle Anbau von Tabak, Kaffee, Sisal und Kautschuk wurde parallel von deutschen und später internationalen Unternehmern betrieben. Die lokale Bevölkerung profitierte kaum oder gar nicht von dem sich Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts etablierenden Anbau solcher Pflanzen für den internationalen Markt. Dies geschah vor allem auf größeren Plantagen im Küstentiefland.

Bei den beiden hier gezeigten Geräten handelt es sich um Astquirle. Die aus einem knapp 50 und knapp 43 Zentimeter langen, geschälten Ast hergestellten Küchenutensilien liegen aufgrund ihrer glatten Oberfläche gut in der Hand und dienen dem Verquirlen von Flüssigkeiten bei der Zubereitung von Speisen. Insbesondere sämige Mischungen oder andere aus verschiedenen Komponenten bestehende Flüssigkeiten, die aufgrund ihrer physikalischen Eigenschaften dazu neigen, sich in Phasen zu fragmentieren, können mittels solcher Quirle wieder gemischt werden, bis die gewünschte, mehr oder weniger homogene Konsistenz entsteht. Der Quirl wird zu diesem Zweck mit dem Kopfende in die Flüssigkeit eingetaucht, die dann durch eine möglichst schnelle, gleichmäßige, gegenläufige Bewegung des Griffs zwischen den gestreckten Handflächen versprudelt wird.
Wie viele andere einfache, aber sehr effiziente Arbeitsgeräte für alltägliche Verrichtungen, waren und sind auch Quirle dieser Art praktisch in allen Weltregionen zu finden. Die Technik ist alt und beispielsweise in Skandinavien seit dem 9. Jahrhundert belegt.
In Tansania dürften Geräte dieser Art v.a. im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Milch Verwendung gefunden haben. Da Milcheiweiß v.a. bei höheren Temperaturen zur Ausflockung neigt, kann dem durch stetiges Verquirlen entgegengewirkt werden. Bei den Vieh haltenden Gesellschaften Ostafrikas, wird Milch darüber hinaus in geeigneten Gefäßen aus Kalebassenkürbissen mit pflanzlichen Extrakten versetzt, die sowohl eine konservierende, als auch geschmackliche Wirkung entfalten. Die bei den hier zu sehenden Quirlen sehr schlank gehaltenen Köpfe haben im Vergleich zu anderen, weiter auskragenden Typen den Vorteil, dass sie problemlos durch die engen Öffnungen der häufig länglich-schmalen Gefäße passen. Aber auch zur Durchmischung heißer Speisen eignen sich die Geräte, da das Holz ein schlechter Wärmeleiter und die Nutzung so auch über offenen Kochgefäßen möglich ist.

Mit dem Evangelium brachten Missionsschwestern, Missionarinnen und Missionare sowie Diakonissen und Diakone der Rheinischen Missionsgesellschaft und der Bethel Mission nicht nur die christliche Botschaft, sondern auch die im Kirchenjahr verankerten Feste in die Welt und etablierten diese in den historischen Missionsgebieten. Das Bild des Monats April zeigt sechs dieser Missionsschwestern der Rheinischen Missionsgesellschaft, aufgenommen 1940 im namibischen Rehoboth:
Eva Peise, Helene Köhler, Erna Okolowitz, Meta Donnowsky, Else Menninger und Frieda Schröder.
Alle diese Frauen haben ihr Leben in den Dienst der Mission gestellt — über 30 Jahre wirkten sie in Südwestafrika und zum Teil zuvor auch im heutigen Südafrika. Der Einsatz Schwestern war zu ihren Lebzeiten geprägt von Entbehrungen, Herausforderungen und belastenden Situationen. So überlebte Schwester Erna Okolowitz im Januar 1954 beispielsweise nur knapp ein Schiffsunglück, bei dem sie einen Schienbeinkopfbruch erlitt und beinahe ertrank. Außer Helene Köhler, die am 30.12. 1958 in Swakopmund verstarb, verlebten alle der hier abgebildeten Schwestern ihren Lebensabend in Deutschland und starben – bis auf Meta Domnowsky, die in Eckernförde beerdigt wurde – in Wuppertal.
Trotz aller Widrigkeiten fanden die Schwestern auch wichtige Momente des Innehaltens und der Gemeinschaft. Das Foto fängt eine solche stille und friedvolle Stunde ein: das gemeinsame Feiern des Osterfestes, ein Fest der Hoffnung und der Auferstehung — getragen von Glaube und Zusammenhalt.
Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM wünscht Ihnen und Ihren Familien ein frohes, gesegnetes und vor allem friedliches Osterfest.

Die auf den Philippinen bolo genannten Messer dieser Art haben ihren historischen Ursprung in Malaysia und breiteten sich von dort auf die indonesischen Inseln und bis in den Norden des philippinischen Archipels aus. Von Beginn an handelte es sich dabei um ein Mehrzweckgerät. Es wurde für alltägliche Arbeiten, als Jagdwaffe und in seiner ursprünglichen Form v.a. auch als Waffe im Rahmen spezieller Kampf(kunst)techniken verwendet.
Das hier gezeigte Messer stammt aus Lubuagan, einem Ort in der Provinz Kalinga, ganz im Norden Luzons, der nördlichsten Hauptinsel des Archipels. Die Klinge misst 33 Zentimeter und weicht nach streng formalen Kriterien von der idealen Beschaffenheit der Klinge eines bolo ab. Das Messer ist jedoch im besten Sinne das, was man heute überall auf den Philippinen unter diesem Begriff versteht. Es handelt sich um ein handgefertigtes Allzweckgerät, wie es Bauern überall im bergigen Hochland nutzen, sei es in der Landwirtschaft, unterwegs im unwegsamen und mit dichter Vegetation bewachsenen Gelände, zur Bearbeitung von Feld- oder Wildfrüchten und ggf. auch zur Verteidigung. In der Regel wird es in einer hölzernen Scheide am Gürtel getragen. Da es sich bei diesem bolo um ein zwar solide, aber sehr einfach und schmucklos gearbeitetes Stück handelt, wurde es vermutlich bereits ohne eine Scheide verkauft, auch um es ganz ohne die schützende Hülle direkt am Körper zu tragen, oder es stets in der Hand mitzuführen.
Auch im Umfeld des Hauses, in der Küche und im Hausgarten werden solche Messer für die alltäglich anfallenden Arbeiten genutzt. In weniger wohlhabenden Familien im ländlichen Raum kann es sich dabei um das einzige Messer des Haushalts handeln.

Die Aufnahme zeigt das Portrait eines jungen Mannes im Anzug mit Fliege und Nickelbrille. Sein Name ist Georg Kunze. Es ist gut möglich, dass das Foto im Jahr seiner Ordinierung und Entsendung als Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) 1888 entstanden ist, vielleicht auch etwas früher. Der gebürtige Dresdner war zum Zeitpunkt der Aufnahme jedenfalls noch keine dreißig Jahre alt, ledig und im Jahr 1883 als Kandidat für die Ausbildung am Seminar der RMG in der Rudolfstraße in Barmen angenommen worden.
Welche Vorstellung er zu diesem Zeitpunkt von seiner künftigen Arbeit in dem für ihn vorgesehenen Missionsgebiet gehabt haben mag, ist ungewiss. Immerhin schreibt er in seinem Lebenslauf für die Leitung der RMG: „Meine Losung sei auch ferner: ich will geführt von deinen Händen beginnen, fortgehen und vollenden.“
Mit der Entsendung beginnt ein ganz anderes Leben, als er es bis dahin gekannt hatte. Auf dem Dampfschiff RMS Quetta gelangt er von London aus über die Häfen in Aden, Colombo und Batavia nach Cooktown in Australien und von dort aus weiter an die Nordostküste Neuguineas, wo er nach insgesamt etwa viereinhalb Monaten auf der Missionsstation in Bogadjim ankommt. Den Rest der Reise auf die Insel Karkar, auf der er eine neue Station errichten soll, legt er in einem offenen Boot übers Meer in eineinhalb bis zwei Tagen zurück.
Die Lebensbedingungen auf der Insel sind für einen Europäer nicht einfach. Mit den dort lebenden Papua muss Kunze den Platz für die Missionsstation und mit ihr seine zukünftige Bleibe aushandeln. Seinen Aufzeichnungen zu Folge, wird er zunächst von der Bevölkerung in seinen Anliegen kaum ernst genommen. Seine Situation verändert sich grundlegend, als er nach etwa einem Jahr, die ihm von der RMG nachgeschickte Bernhardine Keudel aus Mühlheim heiratet. Dem gemeinsamen Haushalt auf der Station ist wenig Zeit beschieden; Bernhardine Kunze stirbt gut ein Jahr später an einer Fiebererkrankung. Drei Jahre danach kommt der Missionar auf Heimaturlaub nach Deutschland, heiratet wieder und reist schließlich mit seiner neuen Frau Johanne erneut nach Neuguinea, wo die beiden die Missionsstation auf Siar betreuen, bevor sie endgültig wieder nach Deutschland zurückkehren. Bis 1905 ist Kunze noch für die RMG im Heimatdienst tätig.
Er stirbt am 6. April 1924 in Halle an der Saale.

Tabak galt im chinesischen Kaiserreich lange als Genussmittel der Oberschicht. Die Pflanze Nicotiana tabacum erreichte China vermutlich im frühen 17. Jahrhundert über die Philippinen. Insbesondere in den südöstlichen Küstenregionen wurde Tabak kultiviert und nach Siam exportiert. Ab dem 18. Jahrhundert etablierten sich neben der „schlanken Gesteckpfeife“ auch Wasserpfeifen als bevorzugtes Gerät des Konsums. Die chinesische Wasserpfeife orientierte sich an indischen Vorbildern und besaß ein konisches Metallgefäß, das optional mit Wasser gefüllt werden konnte und somit als Kühlung diente, um den Rauchvorgang angenehmer zu gestalten. Neben Tabak konnten auch Tabak-Opium-Mischungen (Madak) konsumiert werden.
Im 19. Jahrhundert setzte sich eine kompakte, transportfähige Pfeifenform – wie sie auch auf dem Bild zu sehen ist – bei den Konsumenten durch, ergänzt um eine Kammer zur Tabakaufbewahrung sowie Reinigungsutensilien. Hochwertige Modelle waren oft emailliert und kunstvoll verziert. Die hier abgebildete Wasserpfeife trägt zwei bildliche Darstellungen sowie eingravierte Schriftzeichen:
洞天一品元章石 (Dongtian yipin yuanzhangshi) bedeutet „himmlisches Paradies“, „höchste Qualität“ und „Yuanzhang-Stein“. Dies verweist auf den Taihu-Stein (太湖石), den der berühmte Kalligraf Yuanzhang aus der Song-Dynastie schätzte.
明月三人太白杯 (Mingyue sanren taibai bei) ist eine Anspielung auf den Tang-Dichter Li Bai (李白). Die Gravur zitiert sinngemäß seine berühmte Zeile: „Ich hebe den Becher, lade den Mond ein, und wir sind zu dritt – der Mond, mein Schatten und ich.“
Die Inschriften betonen die hohe Qualität der Pfeife und verweisen auf kulturelle Ideale.

Das Foto zeigt die Familie des Evangelisten Wong a Tün – so die damals übliche Schreibweise seines Namens in der deutschen Übersetzung. Er war am Krankenhaus der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) in Dongguan tätig. Das Spital wurde im Mai des Jahres 1890 eröffnet. Noch im selben Jahr wurden nach den Angaben seines Leiters 10.522 Patienten und Patientinnen während der sogenannten öffentlichen Heiltage behandelt. Unter diesen Menschen wirkte Herr Wong.
Die beiden jungen Männer, die die Familie flankieren, sind jedoch keine Familienmitglieder. Der junge Mann am rechten Bildrand, dessen Name nicht bekannt ist, studierte zum Zeitpunkt der Aufnahme Medizin und arbeitete sehr wahrscheinlich bereits während und nach seiner Ausbildung ebenfalls in dem Missionskrankenhaus der RMG. Bei der Person am linken Rand des Fotos handelt es sich um den Theologiestudenten Wong oi Tong. Zu Beginn der 1950er Jahre leitete er schließlich eine bedeutende christliche Gemeinde in der Region von Dongguan.
Neben den abgebildeten Personen, fallen die Gegenstände auf dem Tisch im Zentrum des Bildes ins Auge. Bei den beiden Büchern dürfte es sich um die Bibel und einen Katechismus oder ein Gesangbuch handeln. Das Gefäß daneben ließe sich zwar auf den ersten Blick einem liturgischen Zweck zuordnen, doch ein in vergleichbaren Anordnungen auf derartigen Fotografien zu findendes Kreuz fehlt. Stattdessen ließe sich auch ein Zusammenhang mit der auf der rechten Tischseite zu sehenden Wasserpfeife herstellen. Dieses einem ganz weltlichen Genuss dienende Gerät und die damit einhergehende Praxis des „Dampfens“ war in China weit verbreitet.
Das Prinzip der Erzeugung von Licht durch den Einsatz von Öllampen ist sehr alt. Am bekanntesten im europäischen Kontext sind wohl die Modelle aus der römischen Antike. Doch dort wurden insbesondere aus Ton gefertigte Lampen bereits in Massenproduktion gefertigt. Der Gebrauch tragbarer kleiner Lampen, die durch die Verbrennung von Talk oder anderen tierischen Fetten über einen Docht Licht erzeugen, reicht nachweislich wesentlich weiter in eine Zeit vor ca. 18.000 Jahren zurück. Mit einer Abdeckung versehen und damit energetisch effizienter, wurden diese Lampen aber erst, als sie mit pflanzlichem Öl befüllt werden konnten. Dies setzte wiederum ein Wissen um die Extraktion solcher Öle aus geeigneten Fruchtkörpern z.B. jenen des Olivenbaums voraus.
Das hier zu sehende Objekt stammt aus China und wurde aus Ton in einer schlichten Ausführung von Hand gefertigt. Es zeigt wie ähnlich sich Lampen dieses Typs praktisch im gesamten eurasischen Raum waren. Ähnliche Formen sind auch aus Mittel- und Vorderasien bekannt. Das Fehlen eines Deckels muss bei dieser Lampe kein Hinweis darauf sein, dass als Brennmaterial Fett anstatt eines Öls verwendet wurde. Stattdessen deutet der fehlende Henkel aber auf eine ausschließliche Verwendung für den stationären Einsatz hin.
Insbesondere im nördlichen China, welches das Winterhalbjahr mit den mittel- und osteuropäischen Breiten teilt, waren es die aktuellen, dunklen Wintermonate, in denen Lampen wie diese dabei halfen, die kurzen Tage dieser Jahreszeit etwas zu verlängern.
Einer von vielen möglichen Gründen, warum sich einzelne Menschen oder ganze Gruppen einer lokalen Bevölkerung in den ehemaligen Missionsgebieten der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) zu einer Konversion zum Christentum bewegen ließen, war die medizinische Versorgung, die ihnen Missionare und Missionsschwestern anboten. Zum einen wirkten deren Behandlungsmethoden manchmal auch gegen Krankheiten, gegen die die lokale Medizin nicht wirksam war, zum anderen war die medizinische Betreuung und Versorgung durch die Mission kostenfrei. Ein Beispiel für eine derart motivierte Konversion ist die Taufe von Ama Gahanoa (1850-1911).
Dieser Mann war innerhalb seines Dorfes auf der Insel Nias eine angesehene Person, nach der sich viele Menschen in der Dorfgemeinschaft richteten. Er war vor allem für seine Besonnenheit, sein Urteilsvermögen und seine Führungsstärke bekannt. Nachdem seine Ehefrau und sein Sohn im Jahr 1893 schwer erkrankten, verstarb seine Frau, wohingegen der Sohn durch die Einnahme der von den Missionaren Adam Fehr und August Lett empfohlenen Medizin überlebte. Wohl auch infolgedessen konvertierte Ama Gahanoa, der sich bereits zuvor entgegenkommend gegenüber den Missionaren verhalten hatte, und nahm durch seine Taufe den Namen Fetero (=Petrus) an. Dieser Schritt spaltete die Dorfgemeinschaft und zu Teilen entgegnete man ihm daraufhin mit Verachtung und Widerstand.
Die RMG nutzte diese Ereignisse in ihrem Sinne und publizierte die Geschichte 1901 in einem ihrer im Eigenverlag erscheinenden, sogenannten Missionstraktate. Unter dem Titel „Fetero oder der goldene Faden der vorbereitenden und berufenden Gnade Gottes“, wurde sie den Spenderkreisen in Deutschland als Erfolg der Missionsarbeit präsentiert.
In der Dauerausstellung des Museums auf der Hardt wird Ama Gahanoa neben anderen Protagonisten der Missionsgeschichte exemplarisch portraitiert. Neben anderen steht seine Geschichte damit für die vielen verschiedenen Aushandlungsprozesse, innerhalb derer christliche Missionare und Missionarinnen aus Europa und die Menschen in Afrika, Asien und Ozeanien im Lauf der Geschichte aufeinandertrafen.

Die Darstellung einer Krippenszene stammt aus der Schnitztradition der Makonde, deren Schnitzer ursprünglich im südlichen Tansania und nördlichen Mosambik beheimatet waren.
Auf den ersten Blick folgt die aus einem Stück dunklen Holzes als Relief herausgearbeitete Szene in ihren Stilelementen der für Krippendarstellungen üblichen Bildsprache. Der symmetrische Aufbau zeigt zwei die Szene umrahmende Engel, die Posaunen zur Verkündigung der Geburt Christi in den Händen halten. Der lediglich als Bogen angedeutete Ort des Geschehens, der Viehstall, wird auf dem Scheitelpunkt von einem Stern gekrönt.
Das Zentrum der Darstellung ist jedoch ungewöhnlich. Zwei Hirten oder aber zwei der drei Könige aus der biblischen Geschichte – klar ersichtlich ist die Zuordnung hier nicht – knien beiderseits des eigentlichen Mittelpunkts der Szene.
Dort wird die heilige Familie zwar noch im schwach ausgearbeiteten Halbrelief, jedoch in einem quadratischen Rahmen und insgesamt nahezu wie in einem Gemälde dargestellt. So wirkt sie einerseits besonders akzentuiert und aus der Szene herausgenommen, andererseits wie in einer Momentaufnahme darin geborgen.

Das hier gezeigte und auf Leinwand angefertigte Acrylbild des Künstlers und Aktivisten Michael Yan Dewis mit dem Titel „Lawan“ (Widerstand) war Teil der virtuellen Ausstellung „Tonawi Mana“, welche die Menschenrechts-situation in Westpapua problematisierte. Die Ausstellung wurde vom papuanischen Kunstkollektiv Udeido kuratiert und am 17. August 2020 eröffnet. „Tonawi“ und „Mana“ sind Begriffe aus der Sprache der Mee (eine Ethnie im Hochland von Westpapua). „Tonawi“ sind weise alte Männer, die sich für die Schwachen und gegen Ungerechtigkeit einsetzen. „Mana“ bedeutet „sprechen“ bzw. „Partei ergreifen“. Michael Yan Dewis selbst ist Mitglied von Udeido, welches 2018 gegründet wurde. Der Name „Udeido“ leitet sich aus dem Wort der Sprache der Mee für eine bestimmte Heilpflanze ab. Diese Pflanze wird als Schmerzmittel verwendet und um die Blutung bei Stich- und Schnittverletzungen zu stillen.
Der Künstler fordert in seinem Bild mit den Schriftzügen „Justice“ und „PapuanLivesMatter“ Gerechtigkeit und nimmt Bezug auf die globale #BlackLivesMatter-Bewegung, die im Sommer 2020 zu internationalen Anti-Rassismus-Demonstrationen führte, nachdem der Afro-Amerikaner George Floyd in den USA durch Polizeigewalt zu Tode kam. Die Papua griffen diese Bewegung auf und riefen mit #PapuanLivesMatter zu mehr Aufmerksamkeit für die Situation in Westpapua auf und forderten ein Ende der Gewalt durch Polizei- und Militär. Die erhobenen Fäuste auf dem Bild symbolisieren den Widerstand der indigenen Papua gegen die seit über 60 Jahren anhaltende Diskriminierung. In Westpapua existiert seit vielen Jahrzehnten eine Form von Rassismus, die sich in täglicher Gewalt und Ungleichbehandlung widerspiegelt. Indigene Papua sind in ihrem Recht auf freie Meinungsäußerung massiv eingeschränkt, werden unrechtmäßig inhaftiert und sind regelmäßig Opfer von physischer Polizei- und Militärgewalt.
Aktuell ist eine Reproduktion des Bildes in der Sonderausstellung „Zeitgenössische Kunst, Kultur und Widerstand in Westpapua“ im Museum auf der Hardt zu sehen.

Der Kopfschmuck aus West Papua beindruckt durch die farbenprächtige Gestaltung des Stirnbands. Seine symmetrische Ornamentik ist aus handelsüblichen gelben Kunstfaserschnüren, roten Pflanzensamenkapseln, Kauri- und anderen Seeschneckengehäusen auf den schwarzen Stoff appliziert. Durch eine Besetzung mit dicht an dicht stehenden Federn eines Kasuars (flugunfähige Laufvogelart) erhält der Kopfschmuck die Anmutung einer Krone.
Zwar kann man diesen traditionellen Schmuck als Besucher oder Besucherin in den touristischen Hotspots der Region selbst erwerben. Als Geschenk – überreicht durch die Vertretenden einer Dorfgemeinschaft, einer Kirchengemeinde oder Nichtregierungsorganisation der Papua – hat das Kleidungsstück eine andere Bedeutung. Der hier gezeigte Schmuck wurde einer Mitarbeiterin des Westpapua-Netzwerks aus Deutschland durch Mitglieder der GKI Tana Papua (Evangelische Kirche im Land Papua) anlässlich eines Besuchs auf der Insel überreicht. Der Schmuck ist nicht nur Zeichen der Gastfreundschaft oder als Ehrung eines Besuchs zu verstehen, sondern auch als ein wichtiges Symbol der papuanischen Identität und kulturellen Eigenständigkeit.
Der Kopfschmuck wird aus diesem Grund auch in der Ausstellung Zeitgenössische Kunst, Kultur und Widerstand in West Papua gezeigt, die ab dem 1. Dezember im Museum auf der Hardt zu sehen ist.

Der Bildausschnitt des Werks The Timako Woo Chronicle des Kunstkollektivs Udeido ist eine Vorschau auf die kommende Sonderausstellung Zeitgenössische Kunst, Kultur und Widerstand in West Papua im Museum auf der Hardt. Er verweist auf zentrale Aspekte der aktuellen Situation in West Papua.
Im Zentrum ist die Verkörperung des mythischen Krokodils der Papua zu sehen, dessen Maul durch die indonesische Fahne gebunden ist. Darüber befindet sich eine Anspielung auf die Farben und Symbole der Morgensternflagge Sempari, dem international wohl bekanntesten Symbol für den Anspruch auf eine eigene Identität der Papua im Westteil der Insel Neuguinea. Beides verweist auf die stark eingeschränkten politischen, sozialen und kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten der Papua in ihrem Land, das sich unter indonesischer Verwaltung befindet.
Ab dem 1. Dezember können Sie in unserem Museum mehr über die zeitgenössische Kunst in West Papua, ihre Rolle für das kulturelle Selbstverständnis und den Widerstand der Papua, aber auch über die Künstlerinnen und Künstler erfahren, die hinter den Kunstwerken stehen.
Das Ausstellungsprojekt wurde von Studierenden der Universität Hamburg konzipiert und umgesetzt. Die Ausstellung wird zum ersten Mal außerhalb Hamburgs zu sehen sein und in Wuppertal um Exponate aus der Sammlung der Archiv- und Museumsstiftung der VEM erweitert. Die Umsetzung wird darüber hinaus vom Westpapua-Netzwerk unterstützt.

Der Schild ist durch eine über lange Zeit tradierte Konstruktionsweise gekennzeichnet. Das auf gut einen Meter Länge, etwa 60 cm Breite oval zugeschnittene, gegerbte Stück Rindsleder ist auf einen entsprechend gebogenen Holzreifen gespannt. Zusätzliche Stabilität verleiht der auf der Abbildung nicht sichtbare, über die gesamte Mittelachse der Rückseite des Schildes verlaufende, starre Tragestock mit mittig ausgewölbtem Handgriff. Die Wölbung nach Außen wird durch entsprechendes Verzurren mit Lederriemen am hölzernen Rahmen erreicht.
Um die Oberfläche mit den Bögen und Flächen aus schwarzen und roten, aus Holzkohle und roter Erde angemischten Farbpigmenten zu versehen, wurde das Leder vor der Gerbung sorgfältig von der Behaarung befreit.
Farbwahl und Anordnung der Flächen sowie die verwendeten Symbole lassen Rückschlüsse auf den Träger des Schildes zu und geben vor allem Auskunft darüber, welcher Altersklasse und geographischer Gruppe er angehört. Das Altersklassensystem bestimmt ganz wesentlich die soziale Organisation der Männer in den Viehhaltergesellschaften Ostafrikas. Innerhalb dieses Systems wiederum ist es der Status eines moran, eines Kriegers, den ein junger Mann anstrebt, um als vollwertiges Mitglied der Gesellschaft anerkannt zu werden. Diesen Status erreicht er einerseits im Kollektiv der Altersklasse im Zusammenhang mit den Initiationsriten und -prüfungen an der Schwelle vom Kindes- zum Erwachsenenalter, andererseits über individuelle Prüfungen, in denen er seinen Mut unter Beweis stellen muss.
Nur ein moran durfte die auch auf dem hier gezeigten Schild zu sehende rote Farbe verwenden. Das rote, halbkreisförmige, von der Fläche darunter durch einen schwarzen Bogen abgegrenzte Emblem am linken Rand des Schildes, dürfte ebenfalls auf eine bestandene Prüfung hinweisen. Junge Männer hingegen, die noch nicht als vollwertige Krieger galten, durften nur schwarze Farbe auf ihren Schilden verwenden.

Otto Hueck wurde am 1. Mai 1888 in Lüdenscheid geboren und wuchs in einer christlich-frommen Familie auf, bevor er ab 1912 sein Medizinstudium an der Universität Kiel absolvierte. Im Anschluss bewarb sich der junge Arzt bei der Rheinischen Mission in Barmen, woraufhin ihm eine Stelle als Missionsarzt in Karibib (damals Deutsch-Südwestafrika) angeboten wurde. Der Erste Weltkrieg und Huecks Einsatz als Truppenarzt machten sein Vorhaben vorerst zunichte, bevor er 1920 gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig schließlich doch im Auftrag der RMG den missionsärtzlichen Dienst in Südchina ausüben durfte. Dort arbeitete er 30 Jahre in Tungkun, im ersten evangelischen Krankenhaus Chinas. Eine besonders schwierige Phase fiel dabei in die japanische Besatzungzeit von 1937 bis 1945. Diese brachte großes Leid über die lokale Bevölkerung und vielen Menschen mangelte es an medizinischer Versorgung. Infolgedessen half Hueck beim Aufbau des Lagers für die Vertriebenen und bei der Betreuung der Bedürftigen, wie er in seinem 1977 erschienenem Werk „Kaiserreich und Kommunismus“ anschaulich berichtet. Seine Maxime bestande darin, dass die Kranken „nicht nur von christlicher Liebe hören, sondern Liebe auch an ihrem eigenen Leib verspüren“ sollten.
1950 mussten alle Missionare die neugegründete Volksrepublik China verlassen. Da Otto Hueck im missionsärtzlichen Dienst jedoch seine Bestimmung gefunden hatte, zögerte er nicht, sich direkt wieder zur Verfügung zu stellen, denn er bezeichnete es als „Gnade, diese Arbeit zu verrichten.“ Somit verbrachte er von 1953 bis 1970 seinen Dienst für die RMG im Norden der indonesischen Insel Sumatra – zuerst in Tarutung, dann in Balige sowie in Pearadja. Erst 1970 kehrte Hueck mit seiner Frau nach Deutschland zurück, um in den Ruhestand einzutreten. Bis kurz vor seinem Tod am 23. Januar 1985 verfolgte er die Geschehnisse um die Mission sowie die politische Situation Chinas und begrüßte dessen Öffnung gegenüber der übrigen Welt ab 1985 freudig. Dass Dr. Marpaung – sein Nachfolger im Krankenhaus in Balige – zur Beerdingung Huecks einen Ulos (ein zeremonielles Kleidungsstück der Batak) über dessen Sarg legte, zeugt von dem großen Ansehen, welches ihm die Christen Indonesiens bis an sein Lebensende entgegenbrachten.
In Bezug auf das Bild bitten wir Sie um Ihre Hilfe:
Können Sie uns sagen, an welchem Gerät Dr. Hueck arbeitet?
Über Hinweise an froese-c@vemission.org würden wir uns sehr freuen.

Alltagsgeräte wie diese Schöpfkelle sind seit Jahrtausenden in Haushalten in nahezu allen Regionen der Welt verbreitet. Dies dürfte der Fall sein, seit die Menschen gelernt haben, das Feuer zu kontrollieren, um es sich unter anderem in einer Feuerstelle zum Garen von Speisen zu Nutze zu machen. Daneben lassen sich mit dem einfachen Prinzip einer an einem Stil befestigten, kleinen Schale über Suppen und Sud hinaus auch Flüssigkeiten aller Art schöpfen, die im Haushalt bzw. bei der menschlichen Grundversorgung eine Rolle spielen. Der Transport kleiner Mengen von Wasser, Milch oder auch Tierblut über kurze Distanzen, sowie das Umrühren in größeren Gefäßen lassen sich bis heute am besten mit einem Gerät wie dem abgebildeten bewerkstelligen.
So einfach das gezeigte Gerät auch in seiner Konstruktion erscheint, so vollendet wird es seiner Funktion gerecht. Der Griff ist aus einer entrindeten Astgabel gefertigt, deren längeres Ende zweifach seitlich durch die Schale einer im oberen Drittel aufgesägten und polierten Kokosnussschale geführt ist. Das kürzere Ende der Gabel dient als Haken zur Aufhängung bzw. Verstauung der Kelle, während der Zeit, in der sie nicht benötigt wird.
So werden nicht nur die Vorteile in der natürlichen Beschaffenheit der Materialien für die Funktionalität des Gerätes voll ausgenutzt. Vielmehr ergeben die Form und Oberflächenstruktur der Materialien für sich, aber auch die stimmigen Proportionen diesem eigentlich alltäglichen Gebrauchsgegenstand eine Ästhetik, die sich kaum leugnen lässt.

Die Geschichte der Rheinischen Mission beginnt bereits mit Gründung ihrer Vorgängergesellschaften: der Elberfelder und der Barmer Missionsgesellschaft. Während sich der Barmer Vorgänger 1818 konstituierte, geschah dies im Fall der Elbefelder Missionsgesellschaft bereits 1799. Somit begann die Geschichte der Mission im pietistischen geprägten Tal der Wupper (damals war noch lange keine Rede von der Stadt Wuppertal, vielmehr standen sich Barmen und Elberfeld in einem Konkurrenzverhältnis gegenüber) vor 225 Jahren. Diese Geschichte macht die Rheinische Mission zu einer der ältesten protestantischen Missionsgesellschaften Deutschlands.
Am Pfingstmontag im Jahr 1799 trafen sich neun Männer am Elberfelder Kerstenplatz im Haus des Lederhändlers Johannes Ball. Neben Ball und seinem Schwiegervater Hermann Pelzer waren sechs weitere Industrielle und Kaufleute aus der Umgebung Balls sowie ein Pastor der reformierten Gemeinde Gründungväter. Allen gemein war eine tiefe Frömmigkeit und ihre christliche Sozialisation.
17 Jahre nach dieser Versammlung schrieb Ball zurückschauend:
„Die Veranlassung der Entstehung unserer Gesellschaft war zum ersten die Nachricht, so wir aus England erhielten, dass dorten eine Gesellschaft errichtet sei, die sich aus Liebe gedrungen fühle, den Heiden richtet sei, die sich aus Liebe gedrungen fühle, den Heiden in den Südseeinseln die fröhliche Botschaft zu bringen: Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist vom Himmel gekommen, um euch von den Banden des Fürsten der Finsternis zu befreien.“
Zunächst widmete sich die neugegründete Gesellschaft vor allem der Übersetzung von englischen und niederländischen Missionszeitschriften und – Berichten, der Sammlung von Spenden und der Herausgabe einer eigenen Zeitschrift. Unter anderem durch die Bemühungen ihres Mitglieds Wilhelm Leipoldt schloss sich die Elberfelder Missionsgesellschaft im Jahr 1828 mit der Barmer Missionsgesellschaft zu einer neuen, größeren Institution unter dem Namen Rheinische Missionsgesellschaft zusammen. Auch das auf dem Bild zu sehende Wohnhaus von Ball am Kerstenplatz gibt es heute nicht mehr, da die Rheinische Mission in das sogenannte Alte Missionshaus in der Rudolfstraße einzog und fortan ihr eigenes Ausbildungsseminar betrieb. Dieses Haus wurde zu Beginn der 1980er Jahre ebenfalls abgerissen und machte dem jetzigen Gebäude der Vereinten Evangelischen Mission (VEM) Platz.

Bälge wie dieser wurden sowohl zum Anfachen des Feuers eines Brennofens zur Gewinnung von Eisen aus erzhaltigem Gestein als auch zum Erhalt eines Schmiedefeuers genutzt. Auf letzterem wurde das gewonnene Eisen zur Herstellung hochwertiger Alltagsgegenstände geschmiedet. Insbesondere Klingen für Jagd- und Kriegswaffen, aber auch Prestigeobjekte wie Schmuck wurden aus dem dauerhaften Material hergestellt. Diese Produkte hatten von je her einen hohen Stellenwert bei den Menschen der Region. Verbesserte Waffen dank robuster und scharfer Klingen bei Messern und Dolchen, sowie geschliffene Speer-, Pfeil- und Lanzenspitzen ermöglichten eine effektivere Jagd auf Wildtiere und sicherten militärische Überlegenheit. Schmuck aus Eisenperlen oder spiralförmig zu Arm- und Beinschmuck verarbeitete Eisenbänder z.B., waren wiederum Statussymbole für (verheiratete) Hererofrauen.
Der Blasebalg auf dem Foto ist nicht vollständig erhalten. Ihm fehlt nicht nur die lederne Abdeckung über einer der beiden Schalen, die als Kompressionskammern dienen. Es fehlen auch die beiden Holzstäbe die auf die Abdeckungen gesetzt werden müssen, um durch wechselndes Heben und Senken den notwendigen Druck und Luftstrom für das Anfachen des Feuers erzeugen zu können. Nur so kann das Feuer auf die Temperatur gebracht und darauf gehalten werden, die wahlweise für das Schmelzen oder das Schmieden benötigt wird.
Die Handhabung des aus einem einzigen Baumstamm gefertigten Geräts lässt sich jedoch an dem Bild aus Ruanda (s.u.) gut ersehen. Dort sind die hier fehlenden Teile und ihre Bedienung abgebildet. Das identische Feuerungsprinzip in Ost- und Südafrika sowie die sehr ähnliche Bauweise der Bälge verdeutlichen nicht zuletzt, wie erfolgreich diese Technologie einen ganzen Kontinent eroberte.

Die Gewinnung und Verarbeitung von Eisen aus Erzgestein hat auf dem afrikanischen Kontinent eine lange Tradition und ist bereits seit etwa 2700 Jahren nachweisbar. Herzstück der Technologie zur Gewinnung des Materials ist die Schmelze in einem speziellen Ofen. Seine Bauweise variierte je nach Region und Entwicklung des Handwerks über die Jahrhunderte. Das Grundprinzip blieb jedoch gleich und ist auch auf diesem Bild nachvollziehbar.
Das Holzfeuer in der unten liegenden Kammer des aus Lehm errichteten Ofens wird über die reihum angelegten Blasebälge angefacht. Sobald die nötige Temperatur erreicht ist, beginnt die Schmelze des Metalls aus dem darüber eingefüllten Gestein. Das gewonnene Roheisen wird für die spätere Weiterverarbeitung abgeleitet. Zurück bleibt die Schlacke.
Wie hier für Ruanda zu sehen, bildete die Verhüttung von Eisen und dessen Verarbeitung weltweit eine wichtige Grundlage für die kulturelle Entwicklung und die Ausdifferenzierung sozialer Systeme. Nicht zuletzt ermöglichten Waffen aus Eisen ihren Besitzern, Macht auszuüben und Herrschaftssysteme wie jenes der Könige von Ruanda zu etablieren.

Das kleine Ensemble der aus dunklem Holz geschnitzten Figuren findet auf einer nur 13 x 16 Zentimeter messenden Grundplatte Platz. Dargestellt sind drei Frauen einer Bibelklasse, die der ihnen gegenübersitzenden Lehrerin aufmerksam zuzuhören scheinen. Die Lehrerin hält die aufgeschlagene Bibel in ihren Händen, den Kopf aufrecht, das Gesicht ihren Schülerinnen zugewandt; hinter ihr ist eine Tafel aufgebaut.
Die vier Kongolesinnen sind in traditionelle Wickeltücher gekleidet und tragen ihr Haar in geknüpften Frisuren, wie es in dem Land häufig der Fall ist. Konzentriert scheinen sie in ihrem Tun zu verharren.
Die kleine, kunstvoll gestaltete Szene war ein Geschenk der örtlichen Bibelfrauen an eine aus Deutschland entsandte Mitarbeiterin der VEM, die über viele Jahre als Lehrerin in der Region Équateur tätig war. So kam das Ensemble schließlich in die Sammlung der Archiv- und Museumsstiftung der VEM. Das Geschenk dürfte damals mit Bedacht gewählt worden sein und ist wohl auch ein Ausdruck der engen Verbundenheit der Beschenkten mit den Schenkerinnen.

Das Foto zeigt die Teilnehmerinnen eines Bibelkurses, der in der rheinischen Missionsstation in Tungkun, China eingerichtet war. Es fällt auf, dass das Seminar von Frauen sehr unterschiedlichen Alters besucht wurde, die sich aufgrund dessen und ganz offensichtlich in sehr unterschiedlichen Phasen ihres Lebens befanden. Neben Müttern mit ihren Kindern sind hier junge, darunter sicher auch noch unverheiratete Frauen, sowie Vertreterinnen der Großelterngeneration gemeinsam abgebildet. Darüber hinaus sind einige minderjährige Jungen und Mädchen im Vordergrund des Bildes zu sehen.
Über die Art des intergenerationellen Austauschs während der Bibelkurse in solch einer Gruppe lässt sich nur spekulieren. Vielleicht mag die historische Aufnahme die Frage aufwerfen, in welchen heutigen Kontexten eine derartige Altersstruktur im Rahmen einer (Aus-)Bildungsveranstaltung zu finden ist.
Die beiden am linken und rechten Bildrand zu sehenden Missionsschwestern sind Helene Schneider und Marie Linz. Beide Frauen wurden 1951 nach der kommunistischen Machtübernahme aus China ausgewiesen und mussten das Land verlassen. Die alltäglichen Begegnungen und gemeinsamen Veranstaltungen mit ihren chinesischen Geschlechtsgenossinnen fanden damit binnen weniger Tage ein plötzliches und unwiderrufliches Ende.

Tansania, Anfang 20. Jhd.
Bei der Betrachtung erscheint dieser eigentlich alltägliche Gegenstand ästhetisch ansprechend, jedenfalls nicht gewöhnlich. Das ist v.a. dem Material geschuldet, aus dem er gefertigt ist. Denn neben einem Riemen aus gegerbtem Leder und einem Klöppel aus Holz, wurde als Klangkörper der Glocke der Panzer einer Landschildkröte verwendet. Im Vergleich zur wesentlich aufwändigeren Herstellung eines Klangkörpers aus Holz oder gar Metall, sind Schildkrötenpanzer mit wenigen Handgriffen für den Zweck hergerichtet.
Es ist weder bekannt in welcher Region des heutigen Tansania die Glocke gefertigt wurde, noch welches Tier sie getragen haben mag. Da die Vieh haltenden Gruppen der Region für die Rinder ihrer großen Herden i. d. R. andere Typen verwenden, kann man vermuten, dass die hier gezeigte Glocke nicht von solch einem Tier getragen wurde. Wenn sie nicht von vorneherein für den Verkauf evtl. auch als Souvenir gedacht gewesen sein sollte, dürfte sie entweder Kleinvieh wie z.B. einer Ziege angelegt worden sein, oder aber einer (einzelnen) Kuh, die zur Versorgung eines Haushalts mit Milch und zur späteren Schlachtung gehalten wurde.
In beiden Fällen dürften es sehr wahrscheinlich Heranwachsende gewesen sein, die sich zumindest zeitweise um das Tier kümmern mussten. Auch unser Bild des Monats wirft ein Schlaglicht auf diesen Sachverhalt.

Es ist weder bekannt wann, noch an welchem Ort in China das Foto gemacht wurde. Zu sehen sind neun Kinder und Jugendliche, die zu beiden Ufern eines Wasserlaufs sitzen oder stehen. Drei von ihnen halten an langen, vermutlich für die Aufnahme kurz genommenen Stricken je einen Wasserbüffel, wie man sie als Arbeitstiere in der Landwirtschaft einsetzte. Alle, Menschen wie Tiere, schauen scheinbar aufmerksam in die Kamera. Lediglich das am linken Bildrand etwas im Vordergrund stehende Tier hält seinen Schädel nicht still für die Belichtungszeit der Aufnahme. Sein Kopf verschwimmt zu einem grauen Fleck.
Der Betrachtende sieht eine ländliche Szene wie man sie in vielen Regionen der Welt hätte aufnehmen können. Überall wo Viehhaltung möglich ist, waren und sind es häufig Kinder oder Jugendliche, denen die Aufgabe übertragen ist, sich um die Nutztiere zu kümmern. Dies gilt insbesondere für das Hüten, die Stallfütterung und Stallhygiene oder das Tränken.
Damit übertrugen die Erwachsenen in vielen Gemeinschaften den Heranwachsenden die Sorgfaltspflicht für beides: ein wirtschaftliches Gut, das überlebenswichtig war einerseits und andererseits für Lebewesen, die nur bei guter Versorgung in der Lage waren, eben diesen Zweck für die Gemeinschaft zu erfüllen.
Betrachtet man die jungen Menschen neben den Arbeitstieren, mag man eine Ahnung von der Verantwortung bekommen, die ihnen gegeben wurde und von den Erwartungen, die sich daran knüpfen. Die drei Jungen schauen ernst in die Kamera und scheinen sich der Verantwortung bewusst zu sein, die auch als eine Prüfung für das Erwachsenwerden gelesen werden kann

Der erste Rheinische Missionar kam im Jahr 1865 auf die indonesische Insel Nias. In dieser Zeit verfügten die meisten Dörfer über eine Truppe von gut ausgerüsteten jungen Männern, das die Gemeinschaft im Ernstfall vor Angriffen schützen konnte. Aber auch militärische Aktionen gegen als feindlich erklärte Gruppen wurden durch diese Truppen ausgeführt.
Zur typischen Bewaffnung gehörte neben Lanze und Schild auch das Schwert. Die leicht gebogene, breite Klinge, der fein geschnitzte Griff und der am oberen Ende der Scheide angebrachte, aus Rotangfaser geflochtene Korbball waren charakteristisch für diese Waffe. Die zwischen knapp 50 und gut 60 cm lange Klinge machte das Schwert zu einer Waffe, die dem Gegner u. U. schwere Verletzungen zufügte, die auch zu dessen Tod führen konnten.
Das hier zu sehende Schwert misst jedoch gerade einmal 27 cm in der Länge. Es handelt sich um eine Miniatur, wie sie heute auf der Insel in großer Zahl als Souvenir für Touristen und Touristinnen hergestellt wird. Auch Hausmodelle, andere Blankwaffen, Schilde und Skulpturen in miniaturisierter Form finden auf diese Weise als Exponenten kultureller Traditionen auf Nias ihren Markt.

Helene Schmitz wird am 28.7.1867 in Mönchengladbach geboren. Als sogenannte höhere Tochter bricht sie die übliche Schulausbildung ab und erlernt das Schneiderhandwerk.
Nach der Ausbildung setzt sich Helene Schmitz in der Kirchengemeinde ehrenamtlich für die Verbesserung der Situation von Mädchen und jungen Frauen aus dem Arbeitermilieu ein. Solch ein Engagement ist für Frauen ihres Standes nicht ungewöhnlich. Diese Jahre sind prägend für die junge Frau. Nach Anstellungen in Düsseldorf und Berlin bietet sich eine neuen Perspektive: Die Rheinische Missionsgesellschaft (RMG) sucht eine geeignete Person für den Aufbau der Frauenarbeit in China. Am 1.11.1905 reist sie dorthin aus.
In Taiping leitet die Missionarin zunächst zwei Bibelfrauenklassen und wirkt maßgeblich am Aufbau und Betrieb einer Frauenschule mit. Hilfe zur Selbsthilfe ist das Kredo ihrer Arbeit. In ihren Lebenserinnerungen berichtet sie davon, den chinesischen Frauen auf diese Weise emanzipatorische Hilfe gegeben zu haben.
Aus gesundheitlichen Gründen kehrt Helene Schmitz 1912 nach Deutschland zurück. Sie setzt ihr Engagement für die RMG aber fort und hält landesweit Vorträge über die Arbeit in China. In Barmen baut sie ein Wohnheim für die aus dem Dienst für die RMG heimkehrenden Schwestern auf, leitet es ab 1922 und bereitet junge Schwestern auf ihre Ausreise vor.
Sie stirbt am 11.4.1924 in Barmen, nachdem sie – seit dem Juli des Vorjahres erkrankt – die Leitung des Heims von ihrem Bett aus koordinieren musste.

Das aus 48 mit Baumwollfaden an einen Stab geflochtenen Lochmünzen bestehende Model eines Schwerts repräsentiert einen Gegenstand, auf den die Missionare und Missionarinnen der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) während ihrer Arbeit in China sehr häufig trafen.
In vielen Haushalten dienten solche Objekte der Abwehr Übel wollender Dämonen. Sie wurden bevorzugt über dem Bett eines Neugeborenen aufgehängt, um ihm Schutz z.B. vor Krankheit oder gar frühem Kindstod zu gewähren.
Sicher missbilligten die rheinischen Missionare und Missionarinnen diese Praxis, stand der Glaube an Geister und Dämonen doch nicht nur im Widerspruch zu ihren eigenen Glaubensgrundsätzen, auch war sie in ihren Augen ein Hindernis bei der Verbreitung des Christentums, der sie sich verpflichtet hatten. Allerdings waren ihre Missionierungsbemühungen unter der Bevölkerung ab 1847 in den ersten Jahrzehnten wenig erfolgreich. Erst mit der Errichtung von Bildungs- und Gesundheitseinrichtungen, darunter ein großes Krankenhaus in Tunkung/Dongguan, begannen Menschen in deren Einzugsgebiet die neue Religion als Option für sich zu erwägen oder sich für sie zu entscheiden.

Das Bild zeigt die erste Seite der 1829 verfassten Instruktionen der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) für ihre ersten 4 am 30.6.1829 ausgesandten Missionare. Nach einer über 3 Monate dauernden Schiffsreise landeten diese am 7.10.1829 schließlich am südafrikanischen Kap. Nach einer Erkundungszeit, die man mit und bei der Londoner Mission Society verbrachte, gründeten die rheinischen Missionare im Kapland mit Wupperthal am 1.1.1830 die erste eigene Missionsstation. Die eigentliche Arbeit konnte nun also beginnen, doch worin bestand diese überhaupt bzw. welche Aufgaben gedachte die Mission ihren „Sendboten“ zu? Aufschluss darüber geben die ihre Instruktionen.
Auch wenn die Mission überzeugt war, dass „der heilige Geist ein besserer Führer ist, als alle menschlichen Instructionen“, sah es der Vorstand der RMG dennoch als seine „Plicht (an), über einige Theile Ihrer künftigen Wirksamkeit, […] nähere Anweisung zu geben.“ Diese Anweisungen erstrecken sich über 7 Paragraphen, deren Titel wie folgt lauten: „§1 Zweck der Aussendung, §2 Allgemeine Anweisung zur gesegneten Missionswirksamkeit, §3 Besondere Anweisungen für unsere Sendboten, §4 Die Gemeinde Gottes unter den Heiden, §5 Außeramtliche Beschäftigungen, §6 Verhältnis der Brüder unter einander, §7 Verhältniß der Missionsbrüder zu unserem Committee.“
Das Anliegen und Selbstverständnis der RMG bestanden in der Verbreitung des Evangeliums, sodass die grundsätzlichen Handlungsanweisungen infolgedessen u.a. auch das dafür nötige Erlernen der lokalen Sprachen betonten. So heißt es beispielsweise in Punkt 4 „Umgang mit den Heiden“ von Paragraph 3: „Vor allem seid bemüht, ihre Sprache recht bald gründlich zu lernen. Sie werden sich freuen, daß sie Euch auch etwas lehren können, und das wird ein Band zwischen ihnen und Euch binden.“ Wieder aufgegriffen wird das Erlernen der Sprache in Paragraph 4 „Die Gemeinde Gottes unter den Heiden“: „Sobald Ihr könnt, haltet abwechselnd auch Gottesdienst in der Landessprache.“

Dieser kunstvoll gearbeitete Gegenstand diente in den Haushalten der Menschen im Südosten der Insel Borneo (heute unter dem Namen Kalimantan ein Teil Indonesiens) dem Anfachen wie dem Erhalt des Feuers.
Das Gerät erzeugt während des Schwenkens in der Hand durch das feste Flechtwerk zwar einen hinreichenden Luftwiderstand, um die Luft in der direkten Umgebung in Schwingung zu versetzen, ist aber auch materialtechnisch so nachgiebig, dass es durch die Luftbewegung wiederum wenig beansprucht wird und so eine gewisse Langlebigkeit aufweist. Auch der elegant aus um 360º gebogenem Rohrwerk geformte Griff liegt gut in der Hand und ist trotz seines geringen Durchmessers erstaunlich stabil.
Das Muster des Flechtwerks ist besonders schön ausgearbeitet. Es greift eine Formensprache auf, die auch in Flechtarbeiten oder als Malerei auf z.B. aus Holz gefertigten Gegenständen zu finden ist. Gegen ein etwaiges Ausfransen des Flechtwerks schützt nicht zuletzt eine Einfassung aus schwarzem Stoff, der mit Zwirn sauber vernäht wurde. Auch dies verleiht dem Fächer nicht nur eine einnehmende Ästhetik, sondern trägt darüber hinaus vermutlich der Absicht Rechnung, ein haltbares Gerät anzufertigen. Heute würde man die Verarbeitung völlig zu Recht als nachhaltig beschreiben.

In diesem Bild tritt den Betrachtenden ein selbstbewusster, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch junger Mann entgegen. Seine Kleidung weist ihn als einen Angehörigen der Elite der Batak auf Sumatra aus. Es ist nicht bekannt, wann die Aufnahme entstand, doch das Foto muss deutlich vor dem Jahr 1900 angefertigt worden sein, da der Mann mit Namen Pontas Lubantobing am 18. Februar dieses Jahres verstarb.
Pontas Lumbantobing hat auch in seinem späteren Leben, soweit bekannt, keine Aufzeichnungen hinterlassen, in denen er über sich selbst oder über die Zeit, in der er lebte und wie er sie sah Auskunft gegeben hätte. Dennoch wissen wir heute vergleichsweise viel über ihn, wenn auch aus den zeitgenössischen Quellen Anderer, die über ihn berichteten. Als einflussreicher Führer oder Fürst (Raja) einer Gemeinschaft von Batak südlich des Silindungtals suchte er offenbar schon früh den Kontakt zu Missionaren der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG). Diese waren ab den 1860er Jahren in dem Gebiet aktiv, das zu der Zeit formal unter niederländischer Kolonialverwaltung stand. Den Missionsberichten zufolge war Pontas Lumbantobing nicht nur sehr interessiert an europäischer Kultur und wohl auch, so ist zu vermuten, an den politischen und ökonomischen Zielen der Europäer in seinem Herrschaftsbereich. Vielmehr befürwortete er es auch, wenn Angehörige seiner Gemeinschaft sich für einen Übertritt zum Christentum entschieden. Für sich selbst jedoch sah er noch verhältnismäßig lang von der Konvertierung ab und ließ sich erst 1867 taufen. In den 1870er Jahren jedoch half er maßgeblich bei der Übersetzung des Kleinen Katechismus und des Neuen Testaments in seine Muttersprache und wurde darüber hinaus durch die Werbung für die Mission unter der lokalen Bevölkerung zu einem zunehmend wichtigen Partner der Missionare der RMG auf Sumatra.
Noch zu seinen Lebzeiten wuchs die Gemeinde seines Herrschaftszentrums Pearadja auf rund 7.000 und die Zahl der in ganz Silindung lebenden Christen auf 20.000, bevor er kurz nach der Wende zum 20. Jahrhundert dort verstarb.
In deutschen Haushalten ist er etwas aus der Mode gekommen, der Serviettenring. Damals wie heute ist er jedoch ein Accessoire, das meist nur für die festlich dekorierte Tafel aus der Schublade geholt wird, um die Serviette dem Anlass entsprechend auf oder neben dem Teller ansprechend drapieren zu können.
Bei der Betrachtung unseres aktuellen Objekts des Monats mag man sich aber fragen, ob und in welcher Weise die hier zu sehenden Serviettenringe während eines feierlichen Anlasses in einem tansanischen Haushalt um die Wende vom 19. in das 20. Jahrhundert zum Einsatz kamen.
Die aus dreifarbigen Pflanzenfasern kunstvoll in traditionell überlieferter Technik geflochtenen Ringe wurden in der Usambara-Region hergestellt. Die Region im Nordosten Tansanias war damals Teil der Kolonie Deutsch-Ostafrika. Die Bethel Missionare hatten dort neben ihren Missionsstationen auch Schulen und Ausbildungsbetriebe errichtet, darunter Werkstätten zur Herstellung verschiedener Gebrauchsgüter sowie von Kunsthandwerk. Dort bildeten eigens aus Deutschland angeworbene Handwerksmeister Mitglieder aus den im Umfeld der Stationen lebenden, neu entstandenen Gemeinden zu Handwerkern aus. In einer solchen Einrichtung wurden auch die gezeigten Objekte hergestellt. Bestimmt waren sie für den Export nach Deutschland, wo sie auf Missionsfesten oder Weihnachtsbasaren verkauft wurden.
So handelt es sich – obgleich in einer seit Jahrhunderten in Tansania geläufigen Technik hergestellt – um Produkte, die ihrer Funktion nach einer europäischen Mode dienten. Nicht zuletzt sind sie damit in gewisser Weise auch ein Zeugnis für die Globalisierung der Dinge in einer Epoche, in der nicht nur Waren weltweit zu zirkulieren begannen, sondern auch das Leben von immer größeren Teilen der Weltbevölkerung zunehmend in globale Kontexte verflochten wurde.
„Besonders die Sachen aus Hohenfriedeberg, bei denen die Kunst des Drechslers mit der des Tischlers und mit den wunderbar satten Farben der hiesigen Edelhölzer zusammenwirkte, erregten Bewunderung. Der Rauchtisch auf dem sechsten Bild gleich von rechts, besteht aus fünf verschiedenen Holzarten. […] Die Sauberkeit der Ausführung besticht von vorneherein und die Zusammenstellung und die Formen zeugen von ganz entwickeltem Geschmack.“ So beschreiben die Missionare Lang-Heinrich und Gleiß in ihrem Bericht in den Nachrichten aus der ostafrikanischen Mission im Januar 1909 ein weiteres Erzeugnis aus den Werkstätten der Bethel Mission in der Usambara-Region im Nordosten der heutigen Republik Tansania.
Anlass ihres Berichts ist die von den Missionaren so genannte Kunst- und Gewerbeausstellung im Ort Vuga, die im Vorjahr als eine Art Leistungsschau für die Betriebe der Missionsstationen in der Region und für die dort erzeugten Produkte initiiert worden war.
Besondere Aufmerksamkeit erhielten dabei die Erzeugnisse aus der Tischlerei und Drechslerei in Mlalo (früher Hohenfriedeberg) wie der kleine Rauchtisch. Ansonsten reichte das Repertoire von Erzeugnissen von kleineren Accessoires bis hin zu einer vollständigen Möblierung für ein Haus nach europäischen Standards, wie es das Bild zeigt.
Im Gegensatz zu den Serviettenringen oder verschiedenen Töpferwahren aus den Betrieben der Bethel Mission, zeigten die Möbel keine Merkmale kultureller Einflüsse aus afrikanischen und europäischen Traditionen. Vielmehr sollten sie in erster Linie den für die Zeit gängigen Normen für in Europa selbst hergestellte Vergleichsprodukte entsprechen. So konnten sie als Beweis dienen, dass die Mission in der Lage war, auch auf den Gebieten des Handwerks und der Ausbildung einen Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung der Kolonie zu leisten. Auch wurde seitens der Missionsgesellschaft erwartet, dass die Stationen Einkommen erwirtschafteten, um zu ihrem Unterhalt beizutragen.
Andererseits trug eine Leistungsschau wie jene in Vuga auch dem Bedürfnis der Missionsgesellschaft Rechnung, ihrer aus heutiger Sicht nicht zu rechtfertigenden Überzeugung von der „kulturellen Hebung“ der Afrikaner durch das protestantische Ethos der „Erziehung zur Arbeit“ Ausdruck zu verleihen.

Skulptur aus dunklem Holz in der Tradition der Makonde-Schnitzerei gearbeitet
Der Künstler arrangierte die Darstellung der Krippenszene auf drei Ebenen in einer klar gegliederten Symmetrie.
Die heilige Familie selbst nimmt die rechte Seite auf der unteren Ebene ein. Das Kind in der Krippe – ganz am unteren linken Rand der aus einem Block gearbeiteten Skulptur platziert – wirkt geradezu unscheinbar. Dennoch bildet es das Zentrum des Geschehens.
Der Künstler erreicht diesen Effekt über die auf das Christuskind fokussierten und dadurch zwangsläufig nach unten gerichteten Blicke aller acht anderen Protagonisten, die in den Ebenen darüber angeordnet sind: neben Maria und Josef findet sich ein ebenfalls kniender Würdenträger (König), seine Gabe darbietend. In der Ebene darüber sind zwei weitere Würdenträger (Könige) zu sehen sowie ein ebenfalls auf das Kind schauender Mann, vermutlich ein Hirte. Den oberen Abschluss der Skulptur bilden – durch ein nur angedeutetes Dach der Behausung von den irdischen Protagonisten etwas abgesetzt – zwei Engel, die nichts desto weniger ebenfalls auf das Kind herabschauen.
In dieser Arbeit handelt es sich bei den dargestellten Menschen zweifellos um Afrikaner. Dies gilt auch für die Darstellung der Engel. So spielt der rechts oben Kniende u.a. eine Schalmei, die der sogenannten sarune, dem traditionellen Blasinstrument in der Küstenregion Ostafrikas nachempfunden ist. Ein weiteres interessantes Detail bildet die Kopfbedeckung des Würdenträgers im Zentrum der zweiten Ebene. Sie mag auf einen Angehörigen des muslimischen Glaubens verweisen, da ein solches Kleidungsstück häufig von Muslimen an der Swahiliküste getragen wird.
„Unerbittlich sendet die Sonne ihre sengenden Strahlen auf die Afrikanische Landschaft hernieder.
Eine träge Ruhe liegt über allem. Kaum rührt sich ein Lebewesen, denn auch die Tiere suchen ein Schattenplätzchen, um sich vor der Sonne zu schützen.
Die Luft flimmert. Das wenige Grün, das die kleinen Gärten noch haben, ist durch die Sonne verbrannt und liegt wie verdorrt am Boden.
Leicht gekleidet erfüllen die Menschen ihre Pflicht. Die Sonne wird gemieden und der Schatten im kühlen Haus aufgesucht. –
Zur gleichen Zeit sitzt man in der lieben Heimat hinter dem waren Ofen oder man rüstet still und heimlich im gemütlichen Zimmer auf die Weihnacht. Tannenduft erfüllt den Raum und die langen Abende geben Muße zum Rüsten auf das Fest. –
So ganz anders ist es draußen in Afrika. All diese äußeren Dinge fehlen, die uns in der Heimat zum Fest so unentbehrlich erscheinen.
Vielleicht, daß man hier in Südwest statt Schnee als Weihnachtsgeschenk einen tüchtigen Regenguß bekommt. Und wenn es geschieht, dann atmen Menschen und Tiere, ja die ganze Natur auf. Selbst die Vöglein zirpen noch in später Abendstunde, als wollten sie ihr Danklied singen für die Kühlung und Erquickung.
Und doch: Es ist Weihnacht! - - Weihnachten in Afrika! – Alles ist gespannt auf das Fest, das nun neu uns künden will: Christ ist geboren!
Es ist Heiligabend. - - Die künstlichen Tannenbäume, geschmückt wie in der Heimat, zieren die Wohnstuben und das Gotteshaus. Auf den Farmen mag es ein Dornbaum sein als Ersatz oder vielleicht nur ein Zweig vom kahlen Wüstengewächs und doch passend in die Oede des Südwester Landes. –
Als sich die Gemeinde am ersten Feiertag zum Gottesdienst sammelt, da spielt es der Posaunenchor, da singt es die Gemeinde und sagt es der Chorgesang weiter:
„O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnachtszeit. Welt ging verloren Christ ist geboren, Freue, freue dich, o Christenheit.“
Ein Text von Missionar Friedrich Wilhelm Mayer, 1936-1972 in Namibia tätig
Indonesien, Nias, 2. Hälfte 20. Jhd.
Dieses 32 cm lange und 34 cm hohe Architekturmodell ist ein detailgetreues Abbild eines Wohnhaustyps, wie er für den äußersten Süden der Insel Nias typisch war. Zwar wurde das Modell weitgehend aus maschinell bearbeitetem Industrieholz in einer einfachen, stabilen Konstruktion hergestellt, es zeigt aber nichts desto weniger die für diesen traditionellen Haustyp wichtigen, äußeren Merkmale.
Häuser wie diese standen in den Siedlungen immer in einem Verband aus mehreren Dutzend bis zu mehr als einhundert Gebäuden. In der Regel waren sie links und rechts der steingepflasterten Straße und des zentralen Platzes dicht an dicht aufgereiht. Die auf dem Bild zu sehende Längsseite des Hauses vermittelt einen guten Eindruck von dem hoch und in spitzem Winkel aufgeführten Walmdach mit den charakteristischen Luken, die bei Öffnung Luft und Licht in den Innenraum ließen und auf diese Weise ähnlich einer Gaube genutzt werden konnten.
Allerdings handelt es sich aus dieser Perspektive nicht um die Schauseite des Hauses. Diese wird vielmehr durch die aus Sicht des Betrachters hier rechts liegende Schmalseite des Gebäudes gebildet. Sie ist es, die der Straßenseite zugewandt ist und sich durch die charakteristisch geschwungen auslaufenden, massiven Bodenschwellen der Konstruktion auszeichnet. Die Schwellen wiederum ruhen auf den mächtigen, zu diesem Zweck senkrecht in die Erde gesenkten, aus massiven Baumstämmen gefertigten Pfeilern. Die hier zu sehende Seite des Hauses kommt dagegen in der Regel sehr dicht an die Wand des meist mehr oder weniger baugleichen Nachbarhauses zu stehen. So fügen sich die Häuser zu einer kompakten Zeile an der Straße entlang zusammen.
Für die Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft, die gegen Ende des 19. Jahrhunderts in die Region kamen, dürfte aufgrund dieser einmaligen architektonischen Ensembles vermutlich der Eindruck entstanden sein, sich eher in einem urbanen Raum zu bewegen, als in einem Dorf. Unterstützt werden mochte dieser Eindruck aber auch durch die vielschichtige soziale Struktur und eine ausdifferenzierte Arbeitsteilung in den Gemeinschaften der Niasser in diesem Teil der Insel.
Bei dem Modell handelt es sich um eines von 53 weiteren Hausmodellen aus einer Privatsammlung, die der Archiv- und Museumsstiftung der VEM vermacht wurden. Sie alle repräsentieren traditionelle Haustypen, wie sie in den vielen verschiedenen Landesteilen Indonesiens, von der Insel Sumatra im Westen bis West Papua im Osten des Inselstaates verbreitet sind. Modelle dieser Art sind als Souvenir sehr beliebt und werden zu diesem Zweck an vielen Orten hergestellt und zum Verkauf angeboten.
Die Objekte der umfangreichen Sammlung hatte ihr Besitzer während seiner Aufenthalte im Land über viele Jahre hinweg entweder erworben, oder er bemühte sich – wo kein direktes Angebot vorhanden war – um eine Auftragsfertigung eines Modells des jeweils lokalen oder regionalen Bautyps.
Tansania, Ende 19. oder Anfang 20. Jhd.
„Yisa nkajilinwa na chala“, so lautet ein altes Sprichwort der Shambaa in den Bergen der Usambara Region im Nordosten Tansanias. So jedenfalls dokumentieren es die Missionare der Bethel Mission Ernst Johanssen und Paul Döring in ihrer 1915 erschienen Publikation „Das Leben der Shambala beleuchtet durch ihre Sprichwörter“.
Die beiden übersetzen die Redewendung etwas umständlich, aber vermutlich sehr treffend: „Mit dem Finger (der nur zeigt, wo man ackern will,) ist das Brachland nicht umgeackert.“ Mit anderen Worten wird hier auf die Tatsache verwiesen, dass sich die Arbeit nicht von allein tut, man vielmehr – und in Bezug auf das aktuelle Objekt des Monats auch ganz sprichwörtlich – die Hacke selbst in die Hand nehmen muss, um sein Feld zu bestellen.
Auffallend ist, dass Johanssen und Döring im ersten Kapitel ihrer Sprichwörtersammlung das „Berufsleben“ im Hinblick auf dort verwendete Redewendungen untersuchten und sich hier wiederum zuerst mit dem Ackerbau befassten. Dieser Einstieg erscheint jedoch naheliegend, da der Feldbau die wichtigste Lebensgrundlage für die Bevölkerung in der Region war, als die ersten Missionare Ende des 19. Jahrhunderts dort eintrafen. Viehzucht, Handwerk und (Tausch-)Handel wurden zwar auch betrieben, waren dem Ackerbau aber nachgestellt. Entsprechend gibt es viele Wendungen, die unter Zuhilfenahme von Sprachbildern aus dem Ackerbau auf allgemeine lebenspraktische wie ethische Aspekte im Hinblick auf Individuen und ihr Zusammenleben in der Gemeinschaft verweisen.
Auch heute leistet der Anbau von Mais, Bananen, Bohnen und anderen Feldfrüchten in der kleinteilig bewirtschafteten Region einen wichtigen Beitrag zur (Selbst-)Versorgung in den Haushalten der ländlichen Bevölkerung. Der Ackerbau war und ist in den Hanglagen des Gebirges arbeitsintensiv. Der Einsatz von Maschinen ist nur sehr eingeschränkt sinnvoll, weder technisch noch was den nötigen Kapitalaufwand für eine solche Bearbeitung betrifft. So sind auch heute ähnliche Ackergeräte wie das hier gezeigte das Werkzeug der Wahl, um den Boden zu bearbeiten.
Ein Missionar oder eine Missionsschwester wurde ausgesandt, um das Christentum im noch zu schaffenden oder schon bestehenden Missionsgebiet einzuführen oder weiter zu verbreiten. Dies war in der Vorstellung der Entsendeorganisationen – der Missionsgesellschaften und Ordensgemeinschaften – in all jenen Weltregionen erstrebenswert, deren Bevölkerungen bisher kaum oder gar keine Berührung mit der christlichen Religion hatten.
Die hinter dem Entsendungsbegriff stehende Idee beinhaltete daher notwendigerweise die Bereitschaft der Missionare, sich auf die Reise zu den Menschen zu begeben, auf die sich ihr Auftrag bezog. Dabei waren zwangsläufig große Distanzen von teils mehreren Tausend Kilometern über Ozeane, auf Straßen, Pisten oder Pfaden und gelegentlich auch auf Flussfahrten zurückzulegen. Das Reisen war zeitaufwändig, oft mit großen körperlichen und psychischen Strapazen sowie nicht selten mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Doch es waren nicht nur deutsche Missionare und Missionarinnen, die in den folgenden Jahrzehnten von Barmen und Bethel von der RMG und der Bethel Mission nach Afrika, Asien, Ozeanien und Amerika entsandt wurden.
Ebenfalls schon früh begaben sich auch Männer und Frauen aus den Missionsgebieten auf die umgekehrte Reise. Sie waren in der Regel Mitglieder der neu entstehenden Missionsgemeinden und einige fühlten sich berufen, selbst missionarisch tätig zu werden. In Europa wurden sie an den Seminaren der Missionsgesellschaften ausgebildet. Die ersten dieser Reisen erfolgten bereits in den 1850er Jahren, ohne jedoch die Kandidaten aus Südafrika nachhaltig für den Beruf ausbilden zu können. Ein anderes Beispiel ist Uerieta Kazahendike, eine junge Frau aus dem heutigen Namibia. Sie begleitete 1860 die Familie des Missionars Carl Hugo Hahn nach Gütersloh in Westfalen, um dort u.a. das Lektorat für die Übersetzung der Bibel in die Sprache der Herero zu leisten. Einige Jahre später machten sich weitere junge Männer aus Asien auf den Weg nach Deutschland, um dort für den Missionsdienst ausgebildet zu werden.
Weit mehr als 2000 Männer und Frauen brachen über die vergangenen nahezu 200 Jahre bis in die Gegenwart für die beiden historischen Missionsgesellschaften und ihre Nachfolgeorganisation, die Vereinte Evangelische Mission (VEM) aus ihrer Heimat auf, um ihren Dienst oder ihre Ausbildung „in der Ferne“ anzutreten. Mit ihnen reisten Ideen, Dinge, Vorurteile, Einsichten und Einstellungen gegenüber den Menschen aus dem jeweils anderen kulturellen Kontext. Diese Einstellungen waren nicht zuletzt auf der Reise und im Kontakt mit den Menschen und ihrer je eigenen Kultur häufig einer nachhaltigen Veränderung unterworfen.
Die Entwicklung vom Reisen zu Fuß, per Pferd und Kamel oder mit sonstigen Lasttieren, sowie von Segel- und Ruderboot zu modernen Dampfern und Motorbooten, über die historische Eisenbahn hin zu modernen Schnellzügen, von Kutschen zu Autos und schließlich zu Kleinflugzeugen und Düsenjets, symbolisiert die rasante Technisierung von Transportmitteln, die auch die Menschen der Mission in den letzten beiden Jahrhunderten genutzt haben. Selbst die sowohl im Barmer als auch im Elberfelder Stadtbild fest verankerte Schwebebahn erfuhr in dieser Zeit Modernisierungen und Erweiterungen.
So werden schon die Erlebnisse und Eindrücke auf der Erstausreise und noch vor dem Eintreffen am eigentlichen Ziel zu unvergesslichen Momenten, die begeistert geschildert werden.
Auch die Gegenwart stellt die Arbeit der aus der Fusion von RMG und Bethel Mission 1971 entstandenen Vereinten Evangelischen Mission (VEM) vor neue Herausforderungen, die mithilfe des modernsten Reisemediums – des Internets – überwunden werden, um den engen Kontakt und die barrierefreie Zusammenarbeit der heutigen Partnerkirchen zu gewährleisten.
Tansania, 1990er Jahre
Wie schon einige in dieser Reihe vorgestellte Objekte, gehört auch das hier gezeigte Kehrblech in die Gruppe der praktischen Haushaltsgeräte, die nahezu überall auf dem Globus aus Recyclingmaterial hergestellt werden. Ausgangsmaterial ist wie so oft Weißblech aus Kisten, die ein Vorleben als Verpackungsmaterial für Verbrauchsgüter verschiedener Art hatten. Gefertigt wurde der in schlichtem aber funktionalem Design gestaltete Gegenstand in Tansania. Er ist ein weiteres Beispiel für die Professionalität und Kreativität in der Wiederverwendung von gebrauchtem Material als Werkstoff, insbesondere von Handwerkern oder auch Künstlerinnen und Künstlern auf dem afrikanischen Kontinent.
Doch der Gegenstand erzählt auch noch eine andere Geschichte. Sie ist aus dem Vorleben des Walzbleches ersichtlich, das zu seiner Herstellung verwendet wurde. Der Aufdruck wirbt für das in Deutschland besser unter der Bezeichnung Resochin bekannte Medikament Nivaquine. Es handelt sich dabei um einen industriell hergestellten Wirkstoff, dessen chemische Verbindung dem Chinin ähnelt und damit dem ältesten bekannten Mittel gegen die in den feuchten Tropen weit verbreitete Krankheit Malaria. An der endemischen Krankheit sterben jährlich weltweit mehr als 600.000 Menschen, wobei mehr als 95% der Toten auf dem afrikanischen Kontinent zu beklagen sind (2021 waren es laut Statistik der Weltgesundheitsorganisation, WHO, 593.470).
Das Kehrblech zeugt damit – von dem Handwerker, der es schuf vermutlich nicht ganz absichtslos auf diese Art hergestellt – von einer der größten Herausforderungen für die afrikanischen Gesundheitssysteme, welche die medizinische Behandlung, vor allem aber die Prävention der Malaria zweifellos darstellt. Denn das in großen roten Lettern auf Kisuaheli zu lesende Versprechen „hushinda malaria kabisa!“ (Besiegt Malaria vollständig!) konnte das auch in Europa ab den 1950er Jahren zugelassene Medikament letztlich nicht einlösen. Viele der Erreger der heutigen Malariavarianten sind mittlerweile vollständig resistent gegen den Wirkstoff des Präparates. Den Schutz der ganzen Familie – wie es das neben dem Slogan aufgedruckte Foto suggeriert – kann es heute nicht mehr leisten.
Zwar stellte sich die Situation diesbezüglich vor gut 25 Jahren noch etwas anders dar, doch neben der medizinischen Wirksamkeit eines Medikaments war damals und ist heute der eingeschränkte Zugang zu solchen Medikamenten für weite Teile der Bevölkerung ein Problem. Das kann sowohl aufgrund mangelnder grundlegender Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum oder in Krisengebieten der Fall sein und/oder aufgrund mangelnden Einkommens der Menschen, um sich pharmazeutische Produkte dieser Art leisten zu können. Insofern kann man das Kehrblech auch sinngemäß als einen Spiegel der globalen sozioökonomischen Strukturen sehen, in denen der gleichberechtigte Zugang zu lebenserhaltenden Ressourcen – nicht nur im medizinischen Bereich – weiterhin vielen Menschen und insbesondere in Afrika verwehrt bleibt.
Liest man „hushinda malaria kabisa!“ vor diesem Hintergrund eher als einen Appell denn als ein Versprechen – auch wenn es der Hersteller des Präparats in seiner Werbung damals wohl eher nicht auf diese Weise verstand – dann dürften die Lösungsansätze vermutlich weniger in einer rein medizinischen, denn in einer gesamtgesellschaftlichen Lösung liegen.
Über die Uhrmacherei in Lwandai ist in den Archivtexten bemerkenswert wenig zu finden. Eine Ausnahme stellen vor allem die weitestgehend erhaltenen Jahresabschlüsse der Betriebe der Missionare der Bethel Mission in Usambara dar. In diesen wird noch bis ins Jahr 1930 rigoros Umsatz und Reingewinn der Uhrmacherei dokumentiert, sogar der Umsatz einzelner Monate wird zum Teil aufgeführt. Ab 1933 ändert dies sich jedoch: die Uhrmacherei bekommt „keine getrennte Rechnung“ mehr, sondern ist allein noch in den Zahlen für die Duka (Kiswahili: Laden/Geschäft/Betrieb), zu denen auch die Schneiderei und die Schuhmacherei zählen, aufzufinden. Der Grund dafür liegt mit Blick auf die desaströsen Zahlen der Uhrmacherei und die allgemeine Lage im Wirtschaftsjahr 1933 auf der Hand: Im Jahr 1930 wurden insgesamt 404 Uhren, also weniger als zwei pro Werktag, repariert, mit einem Reingewinn von nur 106 sh. Die Betriebe insgesamt standen im Jahr 1933 bei einem Reingewinn von 603 sh, was weniger als der Hälfte des betrieblichen Reingewinns der umliegenden Jahre entspricht.
Wir können allerdings gerade wegen der ausbleibenden Dokumente über die Uhrmacherei einiges über die Bethel Mission lernen. Entgegen den Beteuerungen, dass alle „Betriebe […] sich im Laufe der Zeit selbst tragen“ müssten, blieb die Uhrmacherei bis zuletzt bestehen. Man war mehr als bereit, über die wirtschaftliche Bedeutungslosigkeit hinwegzusehen, weil die Ziele ganz andere waren: „In all diesen Betrieben […] wächst in den einzelnen Mitarbeitern in der Stille mühsamer, Geduld heischender Kleinarbeit ein kleiner Stand von Heilgehilfen, Druckern, Setzern, Buchbindern, Tischlern, Uhrmachern, Schneidern, Schuhmachern, Schreibern heran. Diese Erziehungsarbeit soll in ihrer Bedeutung für das soziale Gefüge unseres Volkes [hier ist die christliche Gemeinde gemeint] ja nicht übersehen werden.“ In diesem Pathos spiegelt sich das protestantische Arbeitsethos wider, welches von Protagonisten wie Luther und Calvin begründet wurde und sich alsbald als Teil bürgerlicher deutscher Nationalkultur säkularisierte.
Ebenso ist das ganzheitliche Missionsverständnis der VEM in der Arbeit der Bethel Mission präformiert. Indem die Bethel Mission allerhand deutsche Fachmänner (meist aus dem kirchlichen Umfeld) anwarb, um Betriebe und Hospitäler in Tansania zu errichten, erschuf sie einen florierenden Kirchenkomplex, der sich bis in die alltägliche Lebenswelt erstreckte. Im Gegensatz zu einer, wie Habermas es formuliert, „funktionalen Ausdifferenzierung der gesellschaftlichen Subsysteme“ im Westen, eröffnete sich in Tansania eine öffentliche Bedeutung der christlichen Religion, die in Ländern wie Deutschland bereits im Verschwinden begriffen war.
Eingebunden in diese Kontexte (Protestantismus, deutsche Nationalkultur, ganzheitliches Missionsverständnis und kolonialistisches Denken) wirkte die Bethel Mission und mit ihr eine kleine Uhrmacherei in Lwandai.
Namibia, 19. oder Anfang 20. Jhd.
Nur wenige Zentimeter misst dieses einfache und praktische Werkzeug. Es handelt sich um ein Stück Eisen, das flach und sich zu einer Seite verjüngend geschmiedet wurde. Das verjüngte Ende ist zudem in einer scharfen Fase angeschliffen.
Im Sammlungsinventar wird das Objekt als Rasiermesser bezeichnet, wobei es sich mit Blick auf die wahrscheinliche Handhabung präziser als Schaber oder Schabemesser beschreiben lässt. Eine Verwendung zur Bart- oder Haarrasur kann jedoch nicht als gesichert angenommen werden. Zwischen Daumen und angewinkeltem Zeigefinger und gegen den Strich einer Behaarung im flachen Winkel geführt, erscheint auch eine Nutzung zur Bearbeitung von Tierhäuten als sinnvoller Verwendungszweck.
In jedem Fall dürfte die Klinge einen gewissen Wert im Hausrat ihres Besitzers oder ihrer Besitzerin gehabt haben, wie es bei allen aus Eisen geschmiedeten Gegenständen und insbesondere Klingen der Fall war. Die Verarbeitung von Eisenerz war aufwändig und setzte Fachwissen und Professionalität voraus. Aus diesem Grund waren Schmiede in der Bevölkerung im südlichen Afrika geschätzt, ihre Produkte gefragt.
Für die Vieh haltenden und teilweise nomadisch lebenden Gesellschaften, waren Werkzeuge wie dieses in verschiedener Hinsicht praktisch. Zum einen waren Klingen dieser oder ähnlicher Art unverzichtbar bei der Verarbeitung von geschlachtetem Nutzvieh. Zum anderen waren solche Werkzeuge klein und vergleichsweise leicht, sodass sie den Hausrat auf saisonalen Wanderungen mit dem Vieh praktisch kaum belasteten.
Ovamboland, Namibia, um 1964
Ein !Kung-Junge spielt auf einem Musikbogen. Er ist geriffelt. Darüber wird mit dem Stock hin und hergefahren. Die Bespannung wird in den Mund gehalten, die Zunge und der Mund bewegen sich dabei. Der Mundraum dient zur Erzeugung des Klanges. Es entstehen feine Töne.
Der Bogen, das Jagdinstrument, findet sich in dieser Abwandlung auch zur Besingung des Daseins.
Der Musikbogen ist ein Saiteninstrument, bei dem eine oder mehrere Saiten zwischen den Enden eines biegsamen und gebogenen Saitenträgers gespannt sind. Die Saitenspannung wird durch die Biegekraft des meist dünnen und langen Trägerstabes erzeugt. Er gehört zur Gruppe der Stabzithern. Die Sonderform eines Musikbogens ohne Resonanzkörper, bei dem zur Schallverstärkung und Klangmodulation der Mundraum des Spielers dient, wird Mundbogen genannt.
Musikbögen sind oder waren in weiten Gebieten von Afrika, Asien, Europa und auf den beiden amerikanischen Kontinenten verbreitet. Heute liegt ihr Schwerpunkt in Afrika südlich der Sahara. Weltweit die größte Vielfalt an Musikbögen haben die Khoisan im südwestlichen Afrika entwickelt.
Der am meisten gespielte Jagdbogen besitzt eine Schnurschlinge, welche die Saite in der Mitte so teilt, dass zwei tiefe Fundamentaltöne entstehen, deren Differenz ungefähr einen Ganzton beträgt. Der Bogen ist etwas über einen Meter lang, er wird mit der linken Hand mittig gefasst und schräg nach links unten vom Körper weg gehalten. Der Spieler steckt das obere Ende in seinen Mund, sodass die rechte Wange nach außen gedrückt wird. Durch Veränderung des Mundraums kann er mehrere Obertöne verstärken. Der kürzere Saitenabschnitt liegt näher am Mund.
Die abwechselnde Verwendung als Jagd- und Musikbogen hat sich bei den ǃKung bis heute erhalten. Eine andere Technik der ǃKung, den Mundbogen zu spielen ist, den Rücken des Bogens etwa in seiner Mitte an den Mund zu nehmen. Die Oberlippe liegt fest am Bogenstab, mit der Unterlippe führt der Musiker Bewegungen aus, als ob er sprechen würde. Hierbei erzeugt er zusätzliche Geräuschlaute. Die Saite besteht aus einem gedrehten Tierhautstreifen, der an den Stabenden festgewickelt wird. Die Stimmschlinge ist nahe der Bogenmitte angebracht. Über die beiden, um einen Ganzton verschiedenen Fundamentaltöne kann der Spieler durch entsprechende Formung des Mundraums maximal den sechsten Oberton des unteren und den fünften Oberton des höheren Fundamentaltons selektiv verstärken.
(Quelle: Wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Mundbogen)
China, 20. Jhd.
Auch wer selbst kein Instrument spielt und sich vielleicht auch darüber hinaus kaum für Musik interessiert, kennt die Mundharmonika. Klein und handlich ist sie das ideale Instrument für die Hosentasche und unterwegs. Dieser Umstand macht sie solo nahezu überall und jederzeit einsetzbar. Dabei ist es ein vergleichsweise junges Instrument, das erst unter Einsatz eines (teil-)mechanisierten Herstellungsprozesses im ersten Viertel des 19. Jhd. zunächst in Europa gefertigt und gespielt wurde.
Weniger bekannt ist in der Regel, dass es sich bei der Mundharmonika lediglich um eine modifizierte Form eines wesentlich älteren Musikinstruments handelt. Die aus achtzehn Bambusröhren und einem mit diesen verbundenen, hölzernen Windkasten bestehende Mundorgel sheng hat in China eine etwa 3000-jährige Geschichte. Sie zählt damit zu den ältesten, in Ostasien dokumentierten Instrumenten.
Der Klang wird durch das Einblasen von Luft über das Mundstück erzeugt und über das wechselnde Abdecken der Löcher in den Bambusröhren durch die Finger des Spielers variiert. Für die Grundfärbung der Töne ist jedoch eine in jede Röhre eingesetzte, frei schwebende Zunge verantwortlich, an der die eingeblasene Luft vorbeiströmen muss.
Dieses physikalische Prinzip ist es auch, das in der Mundharmonika übernommen wurde. Dies gilt jedoch auch für ein weiteres Instrument, das nicht nur dem Namen nach eine Verwandtschaft impliziert, sondern auch das Musikinstrument der Wahl europäischer Missionare und Missionarinnen im 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts war, wenn es um ihren Evangelisationsauftrag in Afrika, Asien und Ozeanien ging: das Harmonium.
Auch dieses Instrument ist im Vergleich zur chinesischen Mundorgel ein ‚Newcomer‘, der erst 1848 in Frankreich zum ersten Mal gebaut wurde. Das physikalisch-mechanische Prinzip ist jedoch das gleiche wie jenes der Mundorgel, denn der Ton wird über das Einblasen von Luft, hier mittels eines fußbetriebenen Blasebalgs, erzeugt, die dann an Zungen verschiedener Länge vorbei strömt. Lediglich die Steuerung der Tonfolge ist hier auf ein mit einer Tastatur verbundenes Ventilsystem ausgelagert. Dieser Part erfolgt bei dem ‚Urprinzip‘ der sheng über das Wechseln der Lochabdeckung, ähnlich wie bei dem Spiel einer Flöte.
Missionar und Schlosser Ewald Schildmann, 1937 erstmals nach Sidikalang, Sumatra, Indonesien, ausgesandt, schildert in einem Bericht aus dem Jahr 1956:
„Bereits vor längerer Zeit bekam ich von dem batakschen Pfarrer aus Doloksanggul eine Einladung, mit meinen Bläsern zu einem Gemeindefest zu kommen. Dort sollte ich dann auch predigen. Über diese Einladung freute ich mich besonders; denn in Doloksanggul hatte ich vor 18 Jahren, als ich das erste Mal hier nach Sumatra kam, angefangen, bei dem alten Missionar Quentmeier die Bataksprache zu lernen. 4 Monate hatte ich damals auf der Missionsstation gewohnt. Seitdem war ich noch nie wieder in Doloksanggul gewesen … Was ich an Bläsern, Hörnern und übrigem Gepäck in meinem Auto unterbringen konnte, wurde hineingepfropft … Nach etwa fünfstündiger Fahrt hatte ich mein Auto mit meinen Bläsern doch glücklich ans Ziel gesteuert. Wir waren in Doloksanggul. Auch die anderen im Bus kamen bald nach uns an … Natürlich mußten wir sofort nach der Begrüßung erst einmal einige Choräle blasen. So hörten auch die übrigen Bewohner von Doloksanggul, daß wir angekommen waren … Nach dem Essen ging´s in die große neue Kirche. Sie war mit Petroleumlampen erleuchtet, denn in Doloksanggul gab es kein elesktrisches Licht. Die Kirche war berstend voll. Sie ist sehr geräumig und hat etwa 1500 Sitzplätze, jedenfalls sind so viele vorgesehen. Auf den Emporen waren noch keine Bänke, aber da stand die Jugend dichtgedrängt, Schulter an Schulter. Ebenso war´s unten im Kirchenschiff, in allen Gängen, bis draußen vor die Türen. Ich habe noch nie eine so überfüllte Kirche gesehen. Das kam wohl daher, weil sie so viel Raum für Stehplätze bot durch die breiten Gänge und weiten Emporen. Die Gemeinde sang und die Chöre ebenfalls, einige wirklich gut geschult. Vor mir sprach ein junger natakscher Pfarrer aus der Nachbargemeinde. Und dann hielt ich meine Evangelisationspredigt über das Gleichnis vom Senfkorn … Es ist ja auch immer wieder wie ein Wunder, daß die Asiaten trotz allem noch bereits sind, das Wort Gottes aus dem Munde eines Weißen zu hören. Wie ich oben bereits schrieb, kannten mich hier nur noch einige wenige von den Alten. Für diese über 2000 Batak war ich ein völlig fremder Mensch, eben zuerst nur ein Europäer, ein Weißer … Auf diesen Evangelisationsfahrten wachse ich so richtig mit den einzelnen zusammen, denn da kommen sie aus sich heraus und fragen. Was wünscht sich ein Missionar wohl mehr in seiner Arbeite als Prediger und Seelsorger!“
Bild: Teil des Bläserorchesters unter der Leitung von Missionar Schildmann, Doloksanggul 1956
Bali, Indonesien, 20. Jhd.
Die Bevölkerungsmehrheit auf Bali ist hinduistisch geprägt. In der Mythologie des Hinduismus spielt die Welt der Dämonen und verschiedener Geisterwesen eine wichtige Rolle. Ihren sichtbaren Ausdruck finden die Überlieferungen z.B. im Schattenspieltheater wayang kulit und in ritualisierten Tänzen. Während im Schattenspiel die mythischen Protagonisten und Protagonistinnen durch entsprechende Handspielpuppen verkörpert werden, sind es bei den Tanzaufführungen die Masken, die - von ihren Schauspielern geführt - in festgelegten Choreographien Episoden aus dem Wirken der mythischen Wesen darstellen.
Die über Bali hinaus vermutlich bekannteste Maske im Rahmen eines solchen Tanztheaters ist barong kèkèt. Sie verkörpert das Geistwesen banaspati raja. Obwohl banaspati raja in Gestalt des barong als ein augenscheinlich furchterregender Dämon verstanden werden muss, steht er nichts desto trotz für das Gute, das positive Element in der balinesischen Mythologie. Verständlich wird dieser scheinbare Widerspruch, wenn man sich die Funktion des barong als Schutzgeist und Wächter über die Seelen der Verstorbenen vor Augen führt. Seine imposante, Respekt einflößende Erscheinung versetzt ihn in die Lage, die Sphären von Lebenden und Verstorbenen zu trennen und sie gegen übel wollende Mächte zu verteidigen. Beides sind Notwendigkeiten, denen in vielen religiösen Traditionen Süd- und Ostasiens Aufmerksamkeit entgegengebracht werden muss.
Ebenso wichtig ist es, das negative Element, die übel wollenden Mächte und die sie repräsentierenden Geistwesen nicht auszuschließen. Vielmehr wird im balinesisch -hinduistischen Verständnis idealtypisch ein Ausgleich zwischen Gut und Böse immer wieder angestrebt. Das Ringen beider Elemente findet seinen Ausdruck in den Masken und ihrer Führung während der entsprechenden Choreographien. So findet barong seine Widersacherin in rangda. Sie isteine Verkörperung der Rachegöttin durga, die für die negativen Mächte schlechthin stehen kann.
Bei der hier zu sehenden barong-Maske mit dem rotgefärbten Gesicht, den großen, hervorquellenden Augen und den imposanten Reißzähnen handelt es sich zwar um eine typische Darstellung. Es ist jedoch lediglich eine Nachahmung der Gesichtspartie einer Originaltanzmaske. Zu einer solchen gehört darüber hinaus in der Regel ein mittels Klappmechanismus beweglicher Unterkiefer, eine lange Zunge aus Pergament oder Leder, eine üppige Haartracht aus Palmfaserbüscheln sowie ein voluminöses Kostüm, das von zwei Spielern getragen und in einer gemeinsamen Choreographie durch den Tanz zum Leben erweckt wird.
Erst so kann die Maske zu dem löwenähnlichen Wesen werden, dass nach langem Ringen am Ende des Tanzes über seine Widersacherin rangda siegt. Doch der Sieg über das Böse wird nur bis zu einer erneuten Herausforderung durch rangda bestand haben.
Zeichnung von 1935, Portrait Gottlieb Murangi
Geboren 1900 in der Schweiz kam Liesel Hohl 1924 ins Bibelhaus Malche, wo sie zur Missionslehrerin ausgebildet wurde. Auf eine Anfrage der Rheinischen Mission, die Leitung der Schule in Grootfontein, Südwestafrika, zu übernehmen, führte sie die Schule von 1929 bis 1948. Neben der Schularbeit wirkte sie im Kindergottesdienst und der Evangelisationsarbeit mit. Im Herbst 1948 kehrte Liesel Hohl in ihre Schweizer Heimat zurück, wo sie bis zu ihrer Pensionierung als Lehrerin in Basel tätig war. 1983 verstarb Liesel Hohl.
Ihre künstlerischen Fähigkeiten brachte sie besonders ein und zeichnete viel. So auch Gottlieb Murangi, Hauptevangelist unter den Herero.
Gottlieb Murangi, geboren 1863, war 65 Jahre für die Mission tätig. Getauft wurde er mit 10 Jahren in Otjikango, er unterrichtete Schulkinder und lehrte manchen Missionar die Herero-Sprache. 1909 wurde er von der Regierung zum Polizisten ernannt, bevor er ab 1911 als Wanderevangelist von der Rheinischen Mission angestellt wurde. Missionar Christian Kühhirt, der lange Jahre mit Gottlieb Murangi zusammenarbeitete, schrieb 1950 in Windhoek über ihn: „Unsre Mitarbeiter sind uns nicht nur deshalb nötig, weil sie uns Arbeit abnehmen sollen und müssen, weil wir sie alleine garnicht zu tun vermögen, sie haben auch eine feine, ganz andre Bildersprache. Und wenn sie ihren Volksgenossen das Evangelium verkündigen, ist es naturgemäß viel eindrücklicher und lebendiger, als wenn ein Volksfremder das tut … Freud und Leid teilte er nicht nur mit der Gemeinde, sondern auch mit uns Missionsleuten. Wie hat er sich verantwortlich gefühlt für die Missionarsfrauen, wenn ihre Männer auf Farmreisen waren, er betete mit ihnen, er tröstete sie.“
Gottlieb Murangi war ein bemerkenswerter Mann, der die Arbeit der Mission bereicherte und unterstützte über alle Herausforderungen der Zeit hinaus. Er verstarb am 31. Mai 1948.
China, zweite Hälfte 19. Jhd. oder Anfang 20. Jhd.
Der Resonanzkörper des 13-saitigen Instruments ist mit einer Platte aus Tungholz versehen, in die zwei durch fein geschnitzte Knochenplatten abgedeckte Schalllöcher eingelassen sind. Der Unterbau des Resonanzkörpers und die Abdeckung aus dunkelbraun lackiertem Holz dienen als Koffer für das Instrument. Der ursprünglich sehr wahrscheinlich in mittlerer Position vorhandene Steg ist nicht mehr vorhanden. Das gleiche gilt für die Stöcke zum Anschlagen der Saiten wie für die Stimmwerkzeuge. Bei Instrumenten dieser Art wurden sie in einem Fach aufbewahrt, das sich in der rechteckigen Aussparung an der Vorderseite befand.
Die Yangquin war kein genuin chinesisches Instrument. Erst gegen Ende der Ming-Dynastie (nach 1644) wurde sie aus Vorderasien eingeführt. Während ihr alter Name „fremdländische Zither“ 洋琴 noch darauf verweist, wird sie heute umgangssprachlich auch als Schmetterlingszither 蝴蝶琴 bezeichnet. Dieser Name nimmt Bezug auf die „barocke“ Form, die das Instrument erst etwa ab der Mitte des 19. Jhd. in China erhielt. Sie orientierte sich am Geschmack der Zeit und der Formensprache in der damaligen Möbelindustrie der Guandong-Provinz im Süden des Landes.
Die hier gezeigte Yangquin wurde in Südchina, in der Stadt Guangzhou (Kanton) hergestellt. Die aufgeklebten Etiketten verweisen auf ein Geschäft in der Hao Bin Straße. Die Straße war umgangssprachlich auch unter dem Namen „Musikinstrumentenstraße“ bekannt, da sich zahlreiche Musikalienhändler und Instrumentenwerkstätten dort niedergelassen hatten. Die Stadt am Perlflussdelta wurde auch häufig von Missionaren und Missionsschwestern der RMG aufgesucht, da sie das urbane Zentrum des vergleichsweise kleinen Missionsgebiets der Gesellschaft im Land war. Möglicherweise wurde das Instrument bei einem solchen Besuch erworben.
Bei der Zither handelt es sich darüber hinaus sehr wahrscheinlich um ein Übungsinstrument. Darauf verweisen die beiden schräg verlaufenden Etiketten. Die Schriftzeichen geben eine traditionelle chinesische Notation wieder, nach der man das Spiel erlernen kann.
Das Instrument ist aktuell in der Sonderausstellung „Mission nach Noten – Die Bedeutung der Musik in der Missionsarbeit“ im Rahmen des Themenjahres „Alles in Verbindung“ des Netzwerkes Bergischer Museen zu sehen. Nach Beendigung der Ausstellung kehrt das Objekt wieder ins Depot zurück.
Brief von F. Schneider, Windhoek, Namibia an Missionar F. Harre in Wuppertal vom 12.10.1965
„Sehr geehrter Herr Missionar!
Als Anlage erlaube ich mir, Ihnen unsere erste Schallplatte mit Posaunenmusik zu überreichen. Wenn sie auch nicht so geworden ist, wie wir uns dies vorgestellt haben, so liegt dies einmal daran, dass wir absolut keinen geeigneten Aufnahmeraum haben und zum andern, was die Feinheit des Blasens anbelangt, der Chor noch relativ jung ist. Trotzdem hoffen wir, dass wir Ihnen eine kleine Freude bereiten können und bitten Sie, doch bei Ihren Besuchsreisen auf die Möglichkeit eines Kaufs dieser Platte hinzuweisen. Ich könnte mir vorstellen, dass diese gern als Geschenk, insbesondere zu Weihnachten, verwendet wird. Wenn wir entsprechende Anschriften zur Verfügung haben, nehmen wir den Versand von hier aus direkt vor. Selbstverständlich sind wir auch gern bereit, Ihnen eine Anzahl zu übersenden, falls Sie dies wünschen.
In herzlicher Verbundenheit
Ihr
Fritz Schneider“
Antwortschreiben
Brief von F. Harre (Bild + Film Abteilung. in Wuppertal) an F. Schneider in Windhoek vom 5.11.1965
„Lieber Herr Schneider!
Haben Sie herzlichen Dank für die Übersendung der ersten Schallplatte mit Posaunenmusik. Ich habe mir diese mit großem Interesse angehört und muss Ihnen sagen, dass der Posaunenchor schon allerlei leistet. Ich will gerne bei jeder Gelegenheit auf diese Platte hinweisen. Leider haben Sie nicht mitgeteilt, was diese Platte kostet. Diese Angabe ist wichtig, wenn ich die Platte weiterempfehlen soll.
Wie ich höre, werden Sie evtl. mit einem kleinen Posaunenchor nach hier kommen. Ich glaube, wenn Sie dann in Gemeinden spielen, werden Sie den stärksten Verkauf dieser Platte haben.
Noch interessanter wäre diese Platte, wenn der Posaunenchor nicht nur deutsche Melodien und deutsche Kompositionen spielte, sondern afrikanische. Ich weiß aber nicht, ob es so etwas schon gibt. Ich habe in Südafrika bei den Basutho Komponisten gefunden, die selbst komponierten … Ob Sie so etwas auch schon haben? Das wäre gut, wenn Sie darauf achteten, wenn so etwas zu finden ist, daß wir daran sehr interessiert sind.
Ich habe einige Schallplatten von der Kath. Mission im Kongo, wo afrikanische Musik verarbeitet worden ist. Diese Platten sind sehr interessant und werden bei uns natürlich stärker gefragt, als wenn ein Posaunenchor in Afrika europäische Melodien und Kompositionen spielt.
In der Hoffnung, daß es Ihnen und Ihrer Frau noch gut geht, grüße ich Sie in herzlicher Verbundenheit
Ihr
Fritz Harre
Bild: Die Techniker, Missionar und Schwester, bei der Arbeit im Aufnahmeraum während des 125-jährigen Jubiläums der Rheinischen Mission, da bereits selbstständige Evangelisch Lutherische Kirche, Okahandja, Namibia, August 1967
Papua Neuguinea
20. Jhd.
Der Korpus dieser Trommel wurde aus leichtem Holz in einem Stück gearbeitet und mit aufwändigem Reliefschnitzwerk sowie zwei Handgriffen versehen. Darüber hinaus ist er den Reliefverläufen folgend vielfarbig bemalt. Die Membran über dem Resonanzkörper besteht aus der Haut eines Warans.
Die Verwendung des Trommeltypus hat im Ostteil Neuguineas, dem heutigen Papua Neuguinea, eine lange Tradition, und auch heute werden Trommeln dieser Art dort hergestellt und benutzt. Das gilt sowohl für den Einsatz im religiös-rituellen Bereich wie auch im Rahmen von musikalischen Performances und Feiern von nationalem Rang.
Die Bauweise der Trommel ist dabei passend auf ihren bevorzugten Einsatz abgestimmt. Da die musikalische Aufführung in der Regel immer mit getanzten Choreographien einhergeht, erlaubt der sehr leichte, mit den beiden Griffen versehene Korpus einen im Wortsinn handlichen Einsatz. Er ermöglicht dem Musiker und Tänzer auch schnellere und komplexere Bewegungsabläufe bei der Aufführung.
Varianten dieses Instrumententyps sind in vielen Regionen Neuguineas bekannt. Auch in einer der VEM-Mitgliedskirchen im Hochland von West Papua kommen ähnliche Trommeln bei Gottesdiensten und während anderer Festlichkeiten oft zum Einsatz. Auf diese Weise kann die reiche kulturelle Tradition der Menschen der Region mit der christlichen Religion verbunden werden, die sich erst ab den 1960er Jahren durch Missionare und Missionarinnen der Rheinischen Missionsgesellschaft im Hochland von West Papua verbreitete.
Die Trommel wird in unserer kommenden Sonderausstellung „Mission nach Noten – Die Bedeutung der Musik in der Missionsarbeit“ im Rahmen des dritten Themenjahrs des Netzwerks Bergischer Museen zu sehen sein.
Ferdinand Genähr war 24 Jahre alt, als er in der Stadt Taiping in China die Missionsarbeit für die Rheinische Mission begann. Genähr war ausgebildeter Buchbinder und absolvierte seine Ausbildung am Seminar der RMG von 1843-1846. Er verstarb mit nur 41 Jahren in Hoam.
Anfänge Genährs in Taiping
Die Missionare Genähr und Köster befanden sich in Victoria, dem heutigen Stadtteil Central in Hongkong, um die Sprache zu lernen und Erkundungsreisen in das Umland zu machen. Missionar Köster kam krank von einer dieser Reisen wieder und verstarb bald in Hongkong. Missionar Genähr verließ Victoria und reiste Ende November 1848 nach Taiping, damals über zwei Tage Schiffsreise entfernt von Hongkong.
In den Berichten der Rheinischen Mission heißt es:
„In einem Tage kann man wohl 30 Dörfer von der Stadt aus erreichen, welche sämtliche Bedürfnisse von hier beziehen; fast jedes Haus ist ein Kaufladen; auch sind es Fabriken u.s.w. gar viele im Orte … In den ersten 5 Wochen hatte er [Genähr] viel mit Heilung von allerhand Kranken zu thun … die beiden Prediger [die ihn begleitet hatten und vom chinesischen Verein an seine Seite gestellt waren] gingen in die Stadt und deren Umgegend, um in den Häusern u.s.w. zu predigen … Er [Genähr] ging auch mit seinen Predigern aus.“
Die chinesischen Prediger wurden für mindestens 2 Monate von ihm unterrichtet, um dann im Umland zu predigen. Die erste Person, die Ferdinand Genähr taufte, war der Arzt Ho.
Über die chinesische Sprache schreibt er: „Du [Genähr selbst] wirst das Chinesische nicht erlernen! Ich glaube, daß unter dem mächtigen Beistande des Herrn dieser Berg die Hälfte erstiegen ist, damit will ich nicht sagen, daß die noch zu ersteigende Hälfte mich zum Meister der chinesischen Sprache macht, sondern ich hoffe, daß ich dann eine verständliche Predigt halten und über religiöse Gegenstände in der Volkssprache conversiren kann.“
Auf Ferdinand Genähr folgten zahlreiche Missionare und Schwestern in Taiping.
Namibia, 20. Jhd.
Vor etwas mehr als einem Jahr wurde an dieser Stelle ein Gerät vorgestellt, das sich durch seine Einfachheit, vor allem aber die gleichzeitig bestechende Effizienz für seinen Verwendungszweck auszeichnete. Es handelte sich dabei um einen etwa 55 Zentimeter langen entrindeten Ast, der an einem Ende durch einen präzisen Anschnitt zugespitzt ist und als Grabstock verwendet wurde. Nutzerinnen dieser Geräte waren die Frauen der San und somit Angehörige einer Bevölkerungsgruppe, die vor dem Eintreffen von Afrikanern aus nördlicher gelegenen Teilen des Kontinents und den ersten Europäern das gesamte südliche Afrika bewohnten. Dort führten sie ursprünglich ein Leben auf der Grundlage einer nicht sesshaften Jagd- und Sammel-Ökonomie.
Der hier nun zu sehende Behälter ist mit seinen vergleichbaren Attributen im Hinblick auf Einfachheit und Effizienz ein weiteres Beispiel für die häufig sehr reduzierte materielle Kultur, die allen Gesellschaften eigen ist, welche ein weitgehend nicht sesshaftes Leben, jenseits von wirtschaftlichen Grundlagen wie Ackerbau und Nutzierhaltung führen.
Das Ausgangsprodukt – ein Straußenei – bedarf zur Herstellung des entsprechenden Behälters lediglich der punktuellen Öffnung an der schmaler zulaufenden ‚Kopfseite‘ sowie der Verquirlung und Entleerung seines Inhalts. Der verquirlte Inhalt kann direkt verzehrt werden. Der Behälter selbst jedoch kommt im Gegensatz zum Grabstock der Frauen nur stationär zum Einsatz und wird auch von den Männern für ihre Aufgaben in der traditionell festgelegten Arbeitsteilung der San-Gesellschaft genutzt. Er wird mit Frischwasser befüllt, mit einem Pfropfen aus Lehm verschlossen und in der Erde vergraben. So dient er als Flüssigkeitsdepot. Mehrere dieser kleinen Depots werden strategisch entlang der häufig genutzten Jagd und Wanderrouten angelegt, sodass im Bedarfsfall Trinkwasser entnommen werden kann. Unter den extremen klimatischen Bedingungen in den Steppen und Halbwüsten des südlichen Afrika stellt die Anlage solcher Depots eine Anpassung an die Umweltbedingungen dar, die gegebenenfalls überlebenswichtig sein kann.
Für die Entnahme der Flüssigkeit ist es nicht notwendig, die Eierschalen auszugraben. Vielmehr wird ihr Inhalt nach dem Entfernen des Pfropfens mit einem Saugrohr entnommen. Diese Methode wiederum macht unnötiges Hantieren mit dem, zwar vergleichsweise robusten Behälter überflüssig, erlaubt eine spätere Wiederbefüllung und hält das u.U. verbleibende Wasser durch die unterirdische Lagerung frisch.
Nicht zuletzt finden in den Verwertungsketten der Naturprodukte bei den San auch zu Bruch gegangene Straußeneischalen noch ihre Verwendung. Die Schalenfragmente sind das Ausgangsmaterial für die Herstellung von Schmuck und Applikationen für Kleidungsstücke.
Die Flughunde (Pteropodidae) sind eine Säugetierfamilie aus der Ordnung der Fledertiere und die größte Fledertierart. Sie sind in erster Linie dämmerungs- oder nachtaktiv. Bei der Nahrungssuche legen sie oft weite Strecken zurück, tagsüber schlafen sie kopfüber hängend. Im Gegensatz zu Fledermäusen findet man Flughunde oft auf Bäumen an exponierten Stellen hängend.
Ein weiterer Unterschied zu den Fledermäusen ist das Fehlen der Echoortung. Flughunde haben gut entwickelte Augen und einen ausgezeichneten Geruchssinn. Aufgrund des warmen Klimas in ihrem Verbreitungsgebiet halten sie keinen Winterschlaf. Flughunde ernähren sich pflanzlich.
Die Insel Idjivi, auf der die Flughund-Kolonie lebt, liegt im südlichen Kivu-See, Kongo. Sie wird auch Flughunde-Insel oder auch Napoleon-Island (aufgrund der Silhouette) genannt und ist ein beliebtes Touristenziel.
Das Bild stammt aus einem Konvolut der Bethel-Mission, nähere Erläuterungen zum Jahr der Aufnahme oder wer es gemacht hat, liegen nicht vor.
Die Bethel Mission begann ihre Tätigkeit auf der Insel im Jahr 1909 als erste europäische Missionsgesellschaft.
Tansania
19. oder Anfang 20. Jhd.
Hölzerne Mörser oder auch Stampftröge dieser Art waren vermutlich eines der am weitesten verbreiteten Haushaltsgeräte in Afrika südlich der Sahara und sind teils auch heute noch für die Selbstversorgung im ländlichen Raum im Gebrauch. Darüber hinaus ist das Zerstoßen von Pflanzenteilen bzw. die Weiterverarbeitung von Erntegut zu genießbaren Speisen in dieser Form schon sehr früh in der Menschheitsgeschichte und global nachweisbar. Es handelt sich damit um eine der ältesten Kulturtechniken der Welt.
Seine Entsprechung findet das Gerät in verkleinerter Form und aus Materialien wie Marmor, weiteren Gesteinen mit vergleichbaren physikalischen Eigenschaften, Porzellan, Bronze oder Eisen als unverzichtbares Hilfsmittel in der Pharmazie oder für die Zubereitung feiner Gewürzmischungen in der Küche.
In den Mörsern des hier vorgestellten Typs dürften v.a. Hirse, heimische Knollenfrüchte, aber auch der später in ausreichend feuchten Lagen zunehmend angebaute Mais zur Verarbeitung gekommen sein. Das so aus den stärkereichen Samen und Knollen gewonnene Mehl wird danach in der Regel auf Kochstelle oder Herd zu einem Brei weiterverarbeitet, der als Hauptmahlzeit bzw. als Beilage zu Soßen, Fleisch oder Gemüse gegessen wird.
Die körperlich schwere Arbeit mit dem Mörser wurde und wird von Frauen verrichtet. Das Zerstampfen geschieht durch kontinuierliches Fallenlassen des Stößels in den Mörser. Die physikalische Wirkung auf das zu zermahlende Gut entsteht dabei nicht durch aktives Schlagen, sondern über das Eigengewicht des Stößels beim Fallenlassen bzw. in der Energiefreisetzung beim Aufschlagen nach der Abwärtsbewegung.
Eduard Fries war von 1921 bis 1923 Direktor der Rheinischen Mission. Vor über 100 Jahren, zu Beginn des Jahres 1922 schrieb er in den Berichten der Rheinischen Mission:
„Ein „sursum corda“ zum neuen Jahr!
Wie schwer auch immer wir unter den Nöten gegenwärtiger Zeit leiden müssen, einen großen Segen bringt alle irdische Bedrängnis uns ein: Eindrücklicher nämlich und tiefer als sonst wird die allzeit giltige Wahrheit neutestamentalischen Wortes … uns offenbar, weil gleichartige Situation den deutlichsten Kommentar dazu liefert. Mit wieviel gereifterem Verständnis können z.B. wir Missionsleute nach den Erfahrungen der letzten Jahre lesen und beherzigen, was Paulus im 2. Korintherbrief von der Herrlichkeit spricht … Von dem „uns ist bange, aber wir verzagen nicht“ im 4. Kapitel, bis zu dem ähnlichen Wort „Als die Gezüchtigten und doch nicht ertötet“ im 6. Kapitel: Welch ein Reichtum unversiegbarer Erquickung gerade für uns! …
Vor einiger Zeit lernte ich in einer, aus alter Hugenottenzeit stammenden, reformierten Gemeinde ein wertvolles Kirchensiegel kennen, das im Relief uns einen Palmbaum zeigt, der mit gebogenem Stamm unter der schweren Last seiner Früchte doch schließlich gerade zum Himmel aufwächst; darunter die Inschrift „curvata resurgo“, d.h. „Niedergebeugt richte ich mich empor.“ Das ist das mutige „Dennoch“ einer Berufsauffassung, die in allen Schlägen des Schicksals … die göttlich weise Erziehung erkennt und anerkennt, und es so fertig bringt, sich auch in einer Zeit, da es durch schweres Dunkel hindurchgeht, dankbar zu freuen, statt bloß zu klagen …
Mit vielen bin ich der Zuversicht, daß ganz und gar diese Art unseres Geschlechtes noch nicht zur Sage geworden ist, sondern gerade angesichts einer, noch nie dagewesenen und ungerechtfertigten Unterdrückung sich bewähren wird. Und wenn irgendjemand verpflichtet ist, solche innere Elastizität zu hüten und zu mehren, dann ist´s doch der Christ, der im Glauben Hand und Herz emporheben kann, auch in dieser kommenden Sylvesternacht, mit dem demütigen und zugleich mutigen Bekenntnis: „curvata resurgo“ …
Wir dürfen im neuen Jahr wieder singen: „Zieht in Frieden eure Pfade, mit euch des großen Gottes Gnade und seiner heil´gen Engel Macht“; und es wird so durch den Gang der Dinge, den wir nicht machen können, uns allen laut gepredigt: „Du liebe Rheinischen Mission darfst die Flügel wieder regen … laß die Elastizität des Glaubens nicht verkümmert werden, dann darfst du getrost noch weiter schaffen; mitten in allem Gedränge und unter schwerer Last richte Ich dich empor!“. Mit zagender Seele und schwankender Stimmung entsprechen wir nicht diesen Weisungen Gottes; und wenn wir gebückt laufen, mit dem Blick zur Erde, werden wir seiner Winke nicht gewahr. Darum: sursu „m corda!“, d.h. „die Hände hoch und hoch empor die Herzen“, daß ein einziger Ton freimütigen Bekenntnisses unsere Zuversicht für das neue Jahr bekundet: „curvata resurgo“.
Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2023 Gesundheit, Elastizität im Glauben, Zuversicht und Gottes Segen.
Tansania, Kagera-Region
20. Jhd.
Je nach Qualität aufwendig durch Schlagen, Walken und unter ständiger Befeuchtung hergestellter Rindenbaststoff war im Westen Tansanias und in den benachbarten Regionen Ost- und Zentralafrikas weit verbreitet. Als vielseitiges Alltagsprodukt – etwa für die Fertigung von Kleidern und Decken oder als Verpackungsmaterial – sowie im religiösen Kontext wurde und wird er teils noch verwendet. Bei einigen Bevölkerungsgruppen Ostafrikas begleitete der Stoff die Menschen ein Leben lang: Neugeborene wurden auf ein Stück Rindenbast gelegt, Rindenbastbahnen konnten in der Art eines Teppichs im Wohnraum ausgelegt sein, Verstorbene wurden für die Beerdigung hineingewickelt. Bei den Baganda in Uganda war und ist er Zeichen der Königswürde. Heute ist das Material weitgehend durch die seit dem vorletzten Jahrhundert eingeführten Baumwollstoffe und später auch zunehmend Kunstfaser verdrängt.
Die mit Bibelversen bemalten Tafeln sind vor dem Hintergrund einer kunsthandwerklichen Wiederbelebung der alten Technik zu sehen. Sie verbinden in gewisser Weise gesellschaftliche und religiöse Symbolik, die bereits vor der Missionierung existierte, mit der christlich-europäischen Tradition und Gebrauchsform des Haussegens, welcher als Wandschmuck der Frömmigkeit der Hausbewohner Ausdruck verleihen soll.
Die hier zu sehende Spruchtafel ist mit wechselweise Türkis gefärbten und naturbelassenen Baststrängen gefasst. Der mit schwarzer Farbe aufgemalte und mit weißer Farbe akzentuierte Bibelvers lautet in der Übersetzung aus dem Kisuaheli „Möge die Gnade des Herrn mit euch sein“
Eine Geschichte aus dem kleinen Missionsfreund, einer Zeitschrift der Rheinischen Mission für Kinder, von Frau Martha Pönnighaus, 1926:
„Wenn es bei Euch, Ihr lieben Kinder, Weihnachten werden will, dann sind die Tage kurz und die dunklen Nächte lang; die Sonne scheint nur wenig und steigt nicht hoch am Himmel hinauf und keine rechte Kraft … Sie scheint in der Zeit um so mehr auf der andern Seite der Erde. Und auf dieser andern Seite, da wohnen gerade wir. Wenn es bei Euch im November kalt wird, dann wird´s bei uns recht heiß. Und wenn bei euch der dunkelste Tag ist, kurz vor Weihnachten, dann scheint hier die Sonne am längsten, und man hört den ganzen Tag nicht auf zu schwitzen …
Sie [die Kinder] wollen ja auch gern bei der Weihnachtsfeier sein, wollen den Christbaum sehen und möchten Geschenke bekommen! Und noch in jedem Jahr hat das Christkind den Schulindern etwas gebracht! Aepfel zwar gibt es nicht. Dafür aber ein Stück Brot, das sie sonst selten bekommen, und eine kleine bunte Tasche zum Umhängen … Beim Nähen der Taschen haben die Mädchen helfen dürfen. War das ein Leben in der Nähstube! Jeder Lappen war anders bunt! …
Aber nun wollte ich von Weihnachten erzählen. Endlich war der Tag gekommen. Abends ½ 8 Uhr sollte die Feier sein … Da, ¼ nach 7 Uhr, läutete die Glocke! Ein Sturm von Kindern, ein jubelnder Gesang mit Freudengeschrei wirbelte am Haus vorbei zur Schule! … Noch ¼ Stunde müssen sie sich beherrschen und warten. Dann erst wird die Tür geöffnet … Wir müssen uns mit einem nachgemachten, kleinen Tannenbaum, mit viel Flitter und Kerzen geschmückt, begnügen. Da sieht man´s nicht so, daß er nicht draußen im Wald gewachsen ist … Wie laut und deutlich die Kinder ihre Verheißungen und die Weihnachtsgeschichte aufsagen! … Dann hält der Missionar eine deutsche Ansprache. Jeder Satz wird von einem schwarzen Mann, der dolmetschen kann, in beide Sprachen übersetzt. Der kann wahrhaftig etwas! Außerdem kann er noch Englisch und Holländisch … Nun kommen die Geschenke … Jedes Kind wird aufgerufen und kommt vorn hin, erhält aus der Hand der Missionarsfrau seine Tasche und aus der Hand der schwarzen Lehrerin das Brot … Geordnet verlassen alle nach dem Schlußgesang den Raum. Aber draußen läßt sich die Freude nicht mehr meistern … Aber Freude muß laut werden dürfen, besonders bei Kindern, darum erlauben es die Großen gern und sie freuen sich mit.“
Das Bild zeigt die Kirche von Hoachanas zu Weihnachten. Hoachanas liegt etwas 200 Kilometer von Windhoek entfernt.
Botswana, 20. Jhd.
Einfach – aber sehr funktional: So könnte die Überschrift zu unserem aktuellen Objekt des Monats lauten. Der aus jeweils verfügbaren und geeigneten Pflanzenfasern oder synthetisch hergestellter Schnur fest gebundene Ring diente und dient in weiten Teilen der Welt und insbesondere in Afrika als Tragevorrichtung für Lasten ganz verschiedener Art und unterschiedlichen Gewichts.
Der Durchmesser kann von Modell zu Modell variieren und ist idealerweise an Form und Basisumfang des bevorzugt verwendeten Gefäßes für den Lastentransport oder auch die Beschaffenheit der Last an sich angepasst.
Neben dem Transport von Erntegut oder Verkaufsware ist es auch heute in vielen ländlichen Gebieten, aber auch in sogenannten informellen Siedlungen am Rand oder in den Großstädten ohne ausgebaute Trinkwasserversorgung vor allen Dingen Wasser, das über oft weite Strecken zu Fuß transportiert werden muss. Der schwere Tonkrug, an dessen Basisumfang der Ring am besten angepasst ist bzw. war, hat aber nahezu vollständig ausgedient. Er ist durch wesentlich leichtere, gegebenenfalls auch besser verschließbare Behälter aus Kunststoff zunehmend ersetzt worden. In manchen Regionen finden alternativ auch Aluminium- oder andere Leichtmetallgefäße Verwendung.
Getragen wird die Last, indem man den Ring auf den Kopf setzt und sie auf dem Ring so ein- bzw. anpasst, dass die Last im aufrechten Gang ausbalanciert und möglichst ohne Verlust befördert werden kann. Dabei ist zu beachten, dass es ab einem bestimmten Gewicht nicht mehr möglich ist, die Last allein und aus eigener Kraft auf den Kopf zu heben. Gerade was den Transport von Wasser betrifft, ist die Tätigkeit daher einfacher und effizienter in der Gruppe zu bewältigen, was oft auch der Fall ist.
Es sind nahezu ausschließlich Frauen und Mädchen, in deren alltägliche Arbeitsabläufe diese körperlich schweren Verrichtungen fallen. Das Ausbalancieren der Last erfordert darüber hinaus viel Geschick. Wiederum insbesondere den Transport von Trinkwasser betreffend, sind oft mehrere Kilometer Strecke durch teils schwieriges Gelände zu bewältigen. Die körperliche Beanspruchung ist hoch, auch wenn das Tragen eines Gewichts ausgerichtet in der Verlängerung der aufrechten, sprich vertikalen Körperachse schonender ist im Vergleich zu anderen Arten des Lastentragens, welche Arme, Schultern und Wirbelsäule stärker belasten. Zwar läßt sich der Transport schwererer Lasten mit Hilfsmitteln wie Fahrrädern, Karren oder dem Einsatz von Lasttieren oft besser bewältigen. Doch die Anschaffung und der Unterhalt solcher Hilfen ist immer eine zusätzliche Investition, die sich viele Haushalte nicht leisten können.
Auf der Missionsstation in Mlalo/Hohenfriedeberg, Tansania, wurden zahlreiche Druckerzeugnisse für die Mission hergestellt. Missionsinspektor Walter Trittelvitz schrieb 1911: „Wie war es auch anders möglich, als daß auch bald die Übersetzung der Heiligen Schrift in Angriff genommen wurde? Das Evangelium Markus war das erste … Andere Teile des Neuen Testaments und biblische Geschichten des Alten Testaments in verschiedenen Auflagen folgten, bis im Jahre 1908 das ganze Neue Testament in der vortrefflichen Übersetzung von Missionar Roehl zum Druck gebracht werden konnte … und nun schrieb Elisa Tschagusa, ein junger Schambalachrist, das Manuskript des Neuen Testaments druckfertig mit der Schreibmaschine ab.“
Elisa Tschagusa war Lehrer, unterrichtete Musik, leitete Chöre und war auch Prediger.
„Bei allem zeigte sich die große Schwierigkeit, die darin besteht, ein Buch, das in Afrika geschrieben ist und in Afrika gebraucht werden soll, in Deutschland gedruckt wird. Denn oft genug war niemand in Deutschland, der die Korrekturen lesen konnte. Da mussten die Korrekturbogen zwischen Deutschland und Afrika hin- und herwandern, und jedermann kann sich denken, welch ungeheuere Verzögerung der Druck dadurch erlitt. Darum hat man sich bei den letzten Drucken schon an die Kommunaldruckerei in Tanga gewandt, damit diese den Druck vollziehe … Wir müssen den Schritt tun, den schon so manche Missionsgesellschaft vor uns getan hat, und müssen eine eigene Missionsdruckerei in Usambara errichten … Zum Leiter dieser Druckerei ist ein junger christlicher Buchdrucker ausersehen, der sich schon vor einiger Zeit bei uns zum Missionsdienst gemeldet hatte; er ist augenblicklich hier in Bethel bei Bielefeld tätig, um die letzte nötige Ausbildung zu empfangen.“
Wenige Zeit später konnte, durch Spenden, eine Druckerpresse in Lwandai aufgestellt werden.
Das Bild zeigt Elisa Tschagusa an der Schreibmaschine, an der er die Übersetzung der Bibel für den Druck tippt.
China
19. oder Anfang 20. Jhd
Kleine, aus Ton gebrannte Öfen, waren in China ein nützliches Reiseutensil. Sie ermöglichten unterwegs mit minimalem Aufwand die Zubereitung von Tee oder dienten auch lediglich der Erwärmung von Wasser. Die Fertigung dieses aus gebranntem Ton hergestellten alltäglichen Gebrauchsgegenstandes war mit vergleichsweise wenig Aufwand verbunden; das Gerät an sich aber ein effizienter Reisebegleiter.
Es konnte unter anderem auf den zahlreichen Fracht-und Passagierfahrzeugen zum Einsatz kommen, die auf den großen chinesischen Flüssen verkehrten. Auf ihren Reisen im ehemaligen Missionsgebiet an der Mündung des Perlflusses, etwa zwischen Hongkong und Quangzhou (Kanton) gelegen, dürften auch rheinische Missionare solche Geräte ab und an genutzt haben. Missionare der Gesellschaft waren ab 1847 in dem Gebiet aktiv. Die Öfen konnten aber auch im Gepäck eines Lasttieres oder in einem der typischen einachsigen Wagen für Überlandreisen verstaut werden.
Auch heute ist die Zubereitung bzw. die Bereitstellung von erwärmtem Trinkwasser auf längeren Reisen ein Standard in dem Land.
Das Objekt ist in der Dauerausstellung des Museum auf der Hardt zu sehen.
Nach 30jähriger Tätigkeit war eine zweite Generation der Missionarsfamilien in Südafrika herangewachsen. 1858 waren darunter 49 Missionarstöchter unter 20 Jahren.
Die Deputation der Rheinischen Mission in Deutschland entschied, ein Töchterpensionat in Stellenbosch zu errichten. Das Pensionat sollte auch für andere Mädchen offen und damit die Unterrichtssprache englisch sein. Die in Deutschland ausgewählten Lehrerinnen, Julie Pieper und Bertha Voigt stellten gemeinsam mit den Missionaren Lückhoff und Terlinden das Direktorium.
Es wurden Instruktionen aufgestellt, die neben allgemeinen Entscheidungen für das Pensionat auch die Aufgaben der Lehrerinnen, des Kuratoriums, ferner des Direktoriums festlegten.
„Am 1. Mai 1860 ist eine … Lehranstalt in Stellenbosch eröffnet, ein Erziehungshaus für die Töchter unserer afrikanischen Missionare.“
Im Jahr 1880 besuchten 130 Schülerinnen und über 70 Pensionärinnen das Töchterpensionat, darunter 7 Missionarstöchter. Durch die Schulgebühren und Internatskosten trug sich das Pensionat selbst, eine finanzielle Unterstützung seitens der Mission aus Deutschland war nicht mehr nötig.
Stellenbosch wurde zum Zentrum für die Erziehung und Ausbildung der Töchter der Rheinischen Missionare und ihrer Frauen. Noch heute ist Stellenbosch eine Ausbildungsstätte von Bedeutung. Auf dem Boden des Töchterpensionates, im Zentrum der Stadt, ist ein Teil der heutigen Universität entstanden.
Das Bild zeigt die Rückseite des Töchterpensionats samt Garten, links die Schule, rechts das Wohnhaus. Es handelt sich um eine Zeichnung des Missionars W. Leipoldt, um 1887, der zu den ersten vier ausgesandten Missionaren der Rheinischen Mission gehörte.
Deutschland
Anfang 20. Jhd.
Viele Missionare der Bethel Mission waren als geschulte Theologen auch musikalisch ausgebildet und konnten oft mehrere Instrumente spielen. Das galt auch häufig für deren Ehefrauen oder die für die Gesellschaft ausreisenden Missionsschwestern. Klassische Instrumente der europäischen Musiktradition waren jedoch in den Missionsgebieten nur schwer oder gar nicht erhältlich, bzw. mussten bei Bedarf noch umständlich nachgesandt werden. Da tat man gut daran, sein Instrument von vorneherein auf der Packliste für die Ausreise einzuplanen.
Der hier zu sehende Koffer und ein zugehöriges Cello begleiteten Missionar Siegfried Delius vermutlich bereits 1903 bei seiner Ausreise nach Tanga und in das Digoland im heutigen Tansania. Er und seine Ehefrau Helene, die später nachreiste, arbeiteten dort bis 1919.
Im Gegensatz zu den ebenfalls häufig in die ehemaligen Missionsgebiete ausgeführten Harmonien, steht dieses Objekt nicht in erster Linie für die sakrale Musik im Rahmen der Gottesdienste in den Missionskirchen und war damit nicht dem Hauptaufgabengebiet des Missionars zugeordnet. Viel eher mag es Teil des Privaten im Haushalt einer Missionsfamilie gewesen sein. So dürfte das Cello aus diesem Koffer an zahlreichen Abenden für das häusliche Musizieren bei den Delius’ genutzt worden sein, und wahrscheinlich wurde es in diesem Rahmen auch nicht allein gespielt.
Aus den Berichten der Rheinischen Mission zur Hundertjahrfeier der Rheinischen Mission, die vom 18. – 22. September 1928 im heutigen Wuppertal stattfand:
Vorbereitende Gedanken:
„Die Jahrhundertfeier soll kein äußerliches Gepränge werden, auch kein Brillantfeuerwerk, in dem Menschen und ihr Tun in bengalischem Licht erstrahlen, sondern ein einziges großes Lob des Herrn der Mission selber … Ein verfaßtes Flugblatt, das in zwei mal hunderttausend Exemplaren in die heimatlichen Gemeinden versandt worden ist, hat überall lebhafte Anteilnahme erweckt … Das Proponendum, das die Konsistorien von Rheinland und Westfalen in diesem Jahr den Kreissynoden stellten, behandelte das Verhältnis der heimatlichen Kirche zur Mission … Von den Provinzialsynoden wurde beschlossen, der Rheinischen Mission eine Jubelgabe zu ihrem Jubiläum zu überweisen … Das volkstümlich geschriebene Jubiläumsbuch „Ein Jahrhundert Rheinische Mission“ von Pastor Bonn in Elberfeld war in seiner ersten Auflage von 10000 Exemplaren schon in wenigen Wochen vergriffen …
Am 23. Sept. de, Gründungstag unserer Rhein. Mission soll in allen evangelischen Kirchen im Hinterland unserer Rheinischen Mission des Werkes gedacht werden … Auch in den … Gemeinden draußen wird natürlich der Jubelfeier in besonderer Weise gedacht … Besonders dankbar sind wir auch der Anstalt Bethel bei Bielefeld … Bethel sandte seinen Filmoperateur nach Niederländisch-Indien, der einige wunderbare Filme von der Missionsarbeit auf Sumatra, Nias und den Mentawei-Inseln aufgenommen hat …
Die Jahrhundertfeier muß deshalb dazu dienen, die ganze heimatliche Gemeinde noch einmal wacker zu machen, damit der Missionsgedanke in ihr noch viel lebendiger als wie bisher wird …“
Rückblick auf die Feierlichkeiten:
„Nun liegen sie hinter uns, die Tage der Jahrhundertfeier … Das ganze Fest war von dem herrlichsten Wetter begünstigt … Im Quartieramt des Missionshauses allein hatten sich 17 -1800 Gäste angemeldet … Der Hauptstrom der Gäste kam am Montag. Auf dem Vorplatz des Bahnhofs fiel ihr Blick sofort auf ein großes Plakat mit einem Willkommensgruß … Die Besucher waren alle mit einem besonderen Abzeichen versehen, und wohin man blickte, sah man diese Abzeichen. Eine Wuppertaler Zeitung hatte völlig recht, wenn sie schrieb: „Das Wuppertal zeigt sein wahres Gesicht“ … Eine ganz einzigartige, echt moderne Einleitung erfuhr das Fest durch eine Predigt, die unser Direktor am Sonntag, den 16. Sept. durch das Radio hielt über 2. Kor. 5, 19 u. 20: „Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit ihm selber usw.“ Deren Thema war: „die Sendung der Kirche an die Welt.“ …
Und nun die Versammlungen. Am ersten Festtag versammelten wir uns im kleinen Kreis, der allerdings auch das Schiff der großen Unterbarmer Hauptkirche bis auf den letzten Platz füllte, zu einer stillen Feier … Darauf begaben wir uns in den Saal des Friedensheims, wo in einer sogenannten offiziellen Feier die staatlichen und kirchlichen Behörden der feiernden Missionsgesellschaft ihre Grüße und Glückwünsche darbrachte … Am Abend fanden große öffentliche Missionsversammlungen im Evangel. Vereinshaus zu Barmen und im Jugendhaus von Elberfeld statt mit Ansprachen verschiedener Missionare. Sie waren derart überfüllt, daß Parallel-Versammlungen eingerichtet werden mußten. Mittwoch, den 19. September, vereinigte die Festteilnehmer zu den feierlichen, den eigentlichen Jubiläums-Gottesdiensten, die gleichzeitig in der altgewohnten Unterbarmer Hauptkirche in Barmen und in Elberfeld in der alten reformierten Kirche gehalten wurden … Die Predigt von D. Klingemann wurde durch Radio übertragen …
Am Schluß der Festgottesdienste fand eine einzigartige Gedächtnisfeier statt. Wir begaben uns nach dem Unterbarmer Friedhof. Unter Vorantritt des Posaunenchores unseres Missionshauses … zogen wir in langem, feierlichem Zuge an den Gräbern unserer alten Inspektoren, Lehrer und Missionare vorbei … und legten Kränze nieder … Der Nachmittag brachte dann große Missionsversammlungen … und der Abend noch einmal große Festversammlungen in den beiden Stadthallen mit gleichlautendem Programm: „Mission und Kirche“ … Der eigentliche Gründungstag der Rheinischen Mission war Sonntag, der 23. September. Er wurde dadurch ausgezeichnet, daß an diesem Tage an dem alten Pfarrhaus in Mettmann, in dem vor hundert Jahren der Zusammenschluß erfolgt war, eine Gedenktafel enthüllt und eingeweiht wurde. … Unsere satzungsgemäße Hauptversammlung war in diesem Jahr gleichfalls mit der Jahrhundertfeier verbunden und wies infolgedessen eine Beteiligung auf, wie wohl noch nie. Ueber ihre Verhandlungen zu berichten, ist hier nicht der Ort. Nur sei bemerkt, daß der Beschluß gefaßt wurde, sie dauernd mit unserem Jahresfest zu verbinden, also auf September zu verlegen, um den Abgesandten es dadurch zu ermöglichen, gleichzeitig unser Jahresfest mitzufeiern.“
In diesem Jahr findet die Vollversammlung der VEM vom 23. September bis zum 01. Oktober in Villigst statt. Der Kreis schließt sich.
Das Bild zeigt die Deputation der Rheinischen Mission im Jahr 1928. Heute stellen Männer und Frauen aus Afrika, Asien und Deutschland den Rat der VEM.
China
Ende 19. oder Anfang 20. Jhd.
Neben den industriell von ostasiatischen Nahrungsmittelunternehmen heute hergestellten süßen Snacks, sind auch traditionelle Süßigkeiten aus China, Korea und Japan in den letzten Jahrzehnten in Europa bekannter geworden. Sie erfreuen sich einer gewissen Beliebtheit auch über die ostasiatischen Communities in den europäischen Metropolen hinaus.
Doch während es hierzulande für Liebhaber dieser Snacks der besondere Geschmack und die teils auffälligen Formen, Farben und Konsistenz sind, die zum Konsum anregen, verbinden Menschen aus und in Ostasien eine historisch lange zurückreichende Tradition mit den süßen Kleinigkeiten. Denn sie sind fester Bestandteil des Neujahrsfestes, das nach dem Mondkalender immer in eine Woche zwischen dem 21. Januar und dem 21. Februar des westlichen Kalenders fällt. In dieser Zeit gehören das Schenken und der gemeinsame Genuss von besonderen Speisen und eben auch der Süßigkeiten zu den Feiern und Ritualen rund um das Fest.
Die Palette reicht über geröstete Samen von Kürbis und Lotos über verschiedene Nusssorten bis zu kandierten Fruchtstücken oder ebenfalls kandierten oder gebratenen Scheiben der Lotoswurzel.
Als Geschenk oder zur Präsentation auf dem aufwändig gedeckten Tisch finden Geschenk- oder Präsentationsschachteln in verschiedenen Ausführungen Verwendung, um die Süßigkeiten in ansprechender Form anzubieten. Gemeinsam ist ihnen in der Regel die runde oder achteckige Form, die eine Anordnung der verschiedenen Kleinigkeiten in separaten Schalen rund um ein mit besonderen, auch optisch ansprechenden Leckereien befülltes Zentrum ermöglicht.
Die hier zu sehende Schachtel wurde vermutlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vielleicht auch schon etwas früher aus leichtem Holz gefertigt. Die Grundform ermöglicht die Anordnung von acht trapezförmigen Fächern, die wiederum um ein zentrales achteckiges Fach angeordnet sind. Den Deckel der Schachtel schmückt eine fein gearbeitete Darstellung dreier in prächtige Gewänder gekleideter Personen, die sich um einen Tisch gruppieren. Umgeben sind sie von einer parkähnlichen Szenerie mit üppigem Pflanzenwuchs im Vorder- und Hintergrund. Gerahmt wird die Szene von einem umlaufenden Band aus aneinandergereihten spiralförmigen Elementen.
Johann Schröder junior, geboren in Saron (Südafrika) arbeitet als einer der ersten Rheinischen Missionare mit einer Fotoausrüstung. Nach seiner Seminarzeit in Barmen wird er nach Südafrika und Südwestafrika (heute Namibia) ausgesandt. 1863 nimmt er in wenigen Monaten 250 Fotos auf. Sein Fotoarchiv gilt als verschollen
Johann Georg Schröder wurde 1833 in Saron, Südafrika, geboren. Er war ausgebildeter Schreiner und als Missionar für die Rheinische Mission tätig. Seine Ausbildung am Seminar der Rheinischen Mission erhielt er von 1858-1862. 1863 wurde er nach Südwestafrika ausgesandt.
Sein Haupttätigkeitsfeld lag im Süden des heutigen Namibias, in Berseba, Keetmanshoop, Warmbad und Kommaggas. Von 1871 bis 1880 arbeitete er in Windhuk.
1898 schied er aus dem Dienst der Rheinischen Mission aus.
Johann Schröder war mit Sophie Teuffel verheiratet. Sie hatten 9 Kinder.
Mentawai, Indonesien
Anfang 20. Jhd.
Diese Art der Kopfbedeckung war unter der Bevölkerung der Mentawai-Inseln bei Ankunft der ersten Missionare im Jahr 1901 weit verbreitet.
Der Hut ist aus der glatten Oberhaut der Blattspreiten der Sagopalme (Metroxylon sagu) hergestellt. Das Material ist robust und weitgehend wasserundurchlässig. Die daraus gearbeitete großflächige Kopfbedeckung von 110 Zentimeter Länge und 60 Zentimeter Breite schützt vor länger anhaltenden, starken Regenfällen und starker Sonneneinstrahlung, wie sie für das tropische Inselklima typisch sind. Dies gilt auch für die häufigen Bootsfahrten auf den Flüssen, an den Küsten und im Verkehr zwischen den Inseln des Archipels, da man bei dieser Art des Reisens dem Wetter ansonsten weitgehend schutzlos ausgesetzt wäre.
Nicht zuletzt bedingt die glatte Oberfläche des Materials im Gebrauch schon bald eine leicht schimmernde, nachdunkelnde Patina, die die Dinge auch zu ästhetisch ansprechenden Gebrauchsgegenständen macht. Diese Ästhetik ist kein Zufall, da man ihr auf Mentawai ein großes Gewicht beimisst. Selbst den alltäglichen Gerätschaften sollte auch eine ihre Funktion bekräftigende, angemessene und somit auch das Auge ansprechende Gestalt innewohnen.
Die Kopfbedeckung ist zusammen mit anderen Reiseutensilien der Menschen des Archipels noch bis Ende des Monats in der aktuellen Sonderausstellung „Zwischen den Welten unterwegs – Reisewege der Mission“ im Museum auf der Hardt zu sehen.
Des Meisters Ruf, eine Zeitschrift der Schwestern der Rheinischen Mission, berichtet von der Arbeit der Frauen in den Missionsgebieten. 1910 betrug die Zahl der Abonnenten 2500.
Frieda Schreiber reiste erstmals 1902 nach Pearadja, Indonesien aus, wo sie bis zu ihrer Heirat mit Missionar Zahn 1906 tätig war. Nach ihrer Heirat unterstützte sie ihren Mann in seiner Arbeit in China. Sie erwähnt in ihrem Beitrag aus dem Jahr 1910 den Namen der blinden Tabea, mit der sie tief verbunden war.
Frieda Zahn schreibt: „Sie ist es wert, sie näher kennen zu lernen, da wir Tabea 7 Jahre in unserem Hause bei unseren Kindern hatten. Ihr werdet euch fragen, eine Blinde bei den Kindern? Ja, und wie gut und treu hat sie dieses Amt verwaltet … Ging sie mit dem Baby auf dem Arm durchs Zimmer, dann hielt sie vorsichtig die andere Hand übers Köpfchen … wenn ich in großer Dienstbotennot oder vielleicht selbst krank war, dann konnte ich der Tabea das Kleine getrost überlassen, und was das rührendste war, lehrten wir die Kinder unsere deutschen Gebete, sie lehrte sie die chinesischen. – Als wir im Jahre 1900 flüchten mußten und mein Mann sein in Fukwing liegendes Geld gerne haben wollte, da bot sich die gute Tabea an, es zu holen. Zwei Tage und zwei Nächte mußte sie auf einer chinesischen Dschunke bei stürmischem Wetter zubringen … Trotz ihrer Blindheit fand sie auch wirklich das Geld und brachte es sicher nach Hongkong … Nun ist Tabea schon wieder 7 Jahre von uns getrennt, aber zu jedem Geburtstag unserer Kinder läßt sie mir schreiben …“.
Das Bild zeigt Frieda Zahn mit chinesischen Christinnen. Ob Tabea auch auf dem Bild zu sehen ist, ist nicht überliefert.
Kongo
ca. 1990
Das Modell eines zweimotorigen Kleinflugzeugs ist aus Lötzinn gearbeitet. Das hier entgegen seines eigentlichen Verwendungszwecks genutzte Material ist einerseits biegsam und daher formbar und gut zu verarbeiten, andererseits stabil genug, um die gegebene Form auch bei leichterer Belastung beizubehalten. Die Einzelteile wie Tragflächen, Rumpfgestänge, Fahrgestell, Ruder und Propeller sind durch Bindungen aus dünnem Kupferdraht fixiert.
Das Modell ist Flugzeugtypen nachempfunden, die nicht nur in Zentralafrika, sondern nahezu auf dem ganzen Kontinent im Einsatz sind, um insbesondere abgelegene Ortschaften anzusteuern, die durch das Straßennetz oder schiffbare Flüsse nur schlecht, nur saisonal oder gar nicht zu erreichen sind. Für den Transport von Menschen und Material kommen solche Kleinflugzeuge darüber hinaus überall dort in Betracht, wo nur kaum oder nicht befestigte Landepisten zur Verfügung stehen. Diese sind für größere Maschinen nicht geeignet. Neben staatlichen oder privaten Unternehmen werden Versorgungslinien solcher Art und nicht nur in Afrika auch von der Mission Aviation Fellowship (MAF) betrieben. Dabei handelt es sich um einen internationalen, christlichen Flugdienst, der seine Transporte unter dem Motto „Help, Hope, and Healing for the Isolated“ (Hilfe, Hoffnung und Heilung für isoliert lebende Menschen) einem breiten Spektrum von Hilfsorganisationen u.a. in Krisengebieten anbietet.
Das hier gezeigte Modell erinnert in seiner Machart an Drahtspielzeug, wie es bei Kindern auf nahezu dem gesamten Kontinent beliebt ist. Das handwerklich sehr präzise und aufwendig gearbeitete Stück diente jedoch dem Verkauf. Es wurde im Rahmen eines Projekts für Straßenkinder in Kinshasa gefertigt, um Einkommen zur Unterstützung der von dem Projekt betreuten Kinder zu generieren.
1851
Brief von Gustav Zahn, Superintendent der Rheinischen Mission in Südafrika, schreibt 1851 an seinen Sohn in Deutschland in der Filder Erziehungsanstalt, über seinen Wohnort Steinthal:
„Alles geht hier so still fort, die Leute sind in der Ernte, und die ist dieses Jahr sehr schön. Auf Steinthal ist Alles recht lieblich, und daß ist sehr gut, daß wir bald neu Korn erhalten, da nichts mehr zu haben ist. Die Leute mußten 24 Sch. für eine Mud [Mud war ein in den Niederlanden verwendetes Raummaß vorrangig für Getreide, Anm.] bezahlen, und ich höre und habe es auch gelesen in der Zeitung, daß das Mud Mehl dort, wo der Krieg ist, 10 Pfund Sterling kosten soll. Das ist so viel als man gibt für 10 Mud, wenn es wohlfeil ist.“
1857
Missionar Leipoldt, ebenfalls einer der ersten vier Missionare der Rheinischen Mission, die 1829 nach Südafrika ausreisten und tätig in Wupperthal, schreibt in seinem Reisebericht über den kurzen Besuch in Steinthal:
„Den 5. [November] begann ich des Morgens meine Reise als eben der Tag anbrach, etwa 4 Uhr. … Da der neue, durch’s Gouvernement gemachte Weg wenigstens 3 Stunden um ist, wenn man nach Tulbagh und Steinthal will, so wählte ich den alten über Schurfte und Witzenberg, der aber jetzt so schlecht ist, daß man froh sein muß, wenn man mit unbeschädigten Knochen hinüber kommt. … Gegen Mittag kam ich auf Steinthal (Das Bild von Steinthal liegt bei) bei den lieben Geschwistern Zahn an, die ich mit ihren Kleinen recht wohl fand. Wir konnten und kindlich freuen, einander gesund und wohl zu treffen und hatten viel Ursach unsern treuen Gott und Heiland zu loben und danken, daß er uns mit seiner Freundlichkeit solange getragen hat. Wir theilten uns gegenseitig in traulicher Unterhaltung unsere Erlebnisse und Erfahrungen mit, und genossen recht angenehme Stunden. Wegen Pferde beschlagen wurde ich den andern Tag noch aufgehalten … So machte ich mich den 7. von Steinthal wieder auf den Weg.“
Das von Missionar Leipoldt beigefügte Bild zeigt das Missionshaus in Steinthal, 1857
Nias, Indonesien
19.Jhd. oder früher
In Stein gehauene Figuren wie diese wurden auf der Insel Nias während ritueller Feste aufgestellt. Zu diesem Anlass erhielt der Gastgeber seinen mit Prestige verbundenen Ahnennamen, als wäre er bereits verstorben. Die zum Teil monumentalen Zeugnisse dieser Rituale dienten somit auch als Erinnerungsspeicher für zukünftige Generationen. Auch heute sind solche Steinsetzungen auf der Insel zu finden.
Die aus einem massiven Steinquader gearbeitete Figur hat eine Höhe von gut 1,20 Meter und vereint in sich weibliche wie männliche Merkmale. Kopfbedeckung und Halsschmuck sind typische Attribute einer höher gestellten und angesehenen Persönlichkeit in der Gesellschaft der Niha.
Die Figur ist Teil der Dauerausstellung des Museums auf der Hardt.
Die ersten Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft kamen von der Küste der benachbarten Insel Sumatra aus im Jahr 1865 nach Nias. Es waren u.a. Missionare wie Eduard Fries (1877-1923), die die niassische Kultur während ihrer langjährigen Aufenthalte unter den Menschen auf der Insel eingehend dokumentierten. Zahlreiche Texte, Zeichnungen und Bilder des Missionars geben heute Auskunft über viele Aspekte des Lebens, der gesellschaftlichen Strukturen und kulturellen Praxis auf der Insel vor gut einhundert Jahren.
Johannes Pasaribu wurde als Si Labu in Si Rau, an der Westküste Sumatras, geboren. Den Namen hatten die Eltern in Hinblick auf den Wohlstand und die Ruhe gewählt, die sie in Si Rau gefunden hatten. Labu bedeutet die Ruhe, welche ein Schiff im Hafen findet. Das vorgestellte Si erhebt ein Wort zum Eigennamen.
In Si Rau verlebte er eine frohe Kinder- und Jugendzeit. Mit etwa 6 Jahren begann er, seinen Vater im Garten und auf dem Feld zu unterstützen. Seine Eltern führten ein rechtschaffendes Leben und mehrten ihren Reichtum. Dies neideten ihnen viele und schließlich sahen sie nur eine Möglichkeit: in ein anderes Dorf zu fliehen. Das gelang ihnen nicht und der Vater wurde heimtückisch vom Häuptling des Ortes ermordet. Si Labu konnte mit Hilfe eines Onkels fliehen und landete, nach Umwegen, in Siboga. Dort änderte er seinen Namen in Si Solot (der, der sich angeschlossen hat). Er ging wieder zur Schule, spürte aber immer eine Unruhe, die sich nicht lösen ließ. Zwei Batak, die im Laden des Chinesen in Siboga arbeiteten, erzählten ihm von Missionar Ködding im Silindung-Tal. Nach weiteren Monaten des Zauderns und Haderns machte sich Si Solot 1870 auf den Weg zu ihm, in der Hoffnung, dort innere Ruhe zu finden.
Missionar Ködding nahm Si Solot als Haushaltsgehilfe auf. Bald nahm er auch an der Abendschule teil, die ihm viel Freude bereitete und war seinen Mitschülern so weit voraus, dass Missionar Ködding ihm vorschlug, Lehrer zu werden.
Zuvor jedoch lernte Si Solot das Wort Gottes kennen und bat schließlich Missionar Ködding, getauft zu werden. Er hatte sich, nach mehrmonatiger Vorbereitung, für den christlichen Namen Johannes entschieden.
1873 zog Johannes, zunächst mehr aus Gehorsam, denn aus der Überzeugung, die Fähigkeit, Lehrer zu werden, zu besitzen, ins Lehrerseminar nach Angkola. Dort unterrichteten die Missionare Schreiber, Leipoldt und Staudte. Es war mehr die aufrichtige Liebe und der Glaube, die Missionar Ködding veranlasst hatten, Johannes ins Lehrerseminar zu schicken, als seine große Begabung. Nach drei Jahren schloss er sein Examen ab und wurde Missionar Ködding als Schullehrer und Evangelist zugeteilt.
Er unterrichtete die Kinder in der Missionsschule, zog als Evangelist übers Land und diskutierte erfolgreich mit den Menschen auf den Märkten über den Islam, das Heidentum und das Christentum.
Mit Hilfe Missionar Köddings, der niederländischen Regierung und einer Lösegeldzahlung gelang es Johannes schließlich, nach vielen Jahren, seine Mutter und die Geschwister aus der Gefangenschaft des Häuptlings zu retten und sie nach Siboga zu holen.
In den folgenden Jahren gründeten Johannes und Ködding Missionsfilialen in der Umgebung von Siboga. Muara Hurlang wurde Johannes als Lehrer und Leiter zuteil. Damit einher ging seine Hochzeit mit Thamar, die diesen Namen bei ihrer Taufe durch Missionar Ködding erhielt. Sie wurden Eltern von 8 Söhnen und einer Tochter.
1887 wurde Johannes ausgewählt, mit in den Predigerkursus einzutreten und am 20. Oktober 1889 wurde er, gemeinsam mit seinen Studienkollegen in der Kirche in Pansur na pitu von den versammelten Missionaren ordiniert. Er tat seinen Dienst in Siboga an. Die Zahl der Christen wuchs in diesen Jahren stetig. 10 Jahre arbeitete Pandita Johannes hoch engagiert. 1899 verstarb er im Alter zwischen 45 – 50 Jahren.
Das Bild zeigt Pandita Johannes Pasaribu mit seiner Frau und vier Kindern, um 1890
Kamerun
1990er Jahre
Ganz im Sinne der derzeit zu sehenden Sonderausstellung im Museum auf der Hardt und dem Motto des aktuellen Themenjahrs des Netzwerks der Bergischen Museen
„Alles in Bewegung“, ist auch dieses Spielzeug geeignet, um sich damit sprichwörtlich in Bewegung zu setzen und auf Reisen zu begeben.
Zwar ließen sich die in der Ausstellung vorgestellten, realen historischen Reisewege von Missionaren und Missionsschwestern mit dem aus Draht, Stoff und Gummi gefertigten Gefährt nicht bestreiten. Aber Experten für Phantasiereisen, wie es Kinder nicht nur in Kamerun sind, dürften keine Schwierigkeiten haben, das Gerät in ihrem Sinn zum Einsatz zu bringen.
Die Gliedmaßen der etwa 18 cm messenden Figur des Trommlers sind voll beweglich und über eine einfache wie geniale Haken- (Arme) und Ösen- (Beine) Konstruktion mit der Radachse des Gefährts verbunden. Schiebt man das Vehikel an der langen Führungsstange vorwärts, werden nicht nur die gummiumwickelten Räder in Bewegung versetzt, sondern auch die Arme beginnen im Rhythmus der gewinkelten Antriebswelle auf das vor ihnen vom Fahrgestell her aufmontierte Becken zu trommeln.
Das Spielzeug reiht sich ein in die große Bandbreite der Varianten von Fahrzeugen mit einfacher bis komplexer Mechanik, die ein bequemes Vor-sich-herschieben oder Nachziehen ermöglichen. Sie sind Kindern weltweit in der einen oder anderen Form vertraut. Seine frühen Vorläufer dürften diese Spielzeuge in den meist kaum bearbeiteten Stöckchen haben, mit denen sich bewegliches, gut rollendes natürliches ‚Fundgut‘ antreiben ließ.
Die hochwertige handwerkliche Ausführung und Gestaltung des Objekts verweisen auf eine Herstellung für den Verkauf, der sich (zunächst bzw. auch) an erwachsene Kunden oder Kundinnen richten dürfte, die eine Affinität zur Ästhetik und Funktion eines solchen Gegenstands mitbringen. Erworben wurde er in Douala.
Die erste Taufe durch den Rheinischen Missionar Bergmann fand am 28. Dezember 1903 in Bogadjim statt. Es handelte sich um den jungen Papua Gumbo, der als Hausjunge für Missionar Hoffmann tätig war. Es sollte jedoch viele Jahre dauern, bis tatsächlich eine größere Zuwendung zum christlichen Glauben in Neu-Guinea einsetzte. 1914 kam es in Bongu zur Taufe von 127 Papua an einem Tag. War die Neu-Guinea Mission in ihren Anfängen kein leichtes Unterfangen, so konnte sie seit der ersten größeren Tauffeier 1914 in den Folgejahren bis Ende 1925 3334 Getaufte verzeichnen. Weitere 3573 Papua besuchten den Taufunterricht. Aus den 15 Schulen waren 74 geworden, aus den 518 Schülern 2969. Und insbesondere waren 104 Papua zu wichtigen Helfern der Mission geworden.
Das Bild zeigt die Taufe von 149 Papua in Ragetta, 1923
Tansania, Kagera Region, westlich des Viktoriasees
Ende 19./ Anfang 20. Jhd.
Halsbänder dieser Art wurden Hunden für die Treibjagd angelegt. Noch am Beginn des 20. Jahrhunderts sind aufwändige Treibjagden mit einer Vielzahl an Treibern, Jägern und Hunden in der Region westlich des Viktoriasees in der zeitgenössischen Literatur beschrieben. Jagden dieser Art konnten in der Regel nur von lokalen Führern von entsprechendem Rang organisiert und durchgeführt werden, wie sie sich in Kleinkönigreichen in der Region, angelehnt an die Verhältnisse des großen, benachbarten Königreichs der Baganda im nördlich gelegenen Uganda etabliert hatten.
Für die Jagd machte man sich die Geländeverhältnisse zu Nutze, indem man sich zunächst an den Hängen eines Talkessels formierte und dann mit Jägern, Treibern und Hunden die gebildete Kette kreisförmig Richtung Talsenke absteigend immer enger zog. Das Wild, welches sich bevorzugt in den vegetations- und wasserreichen Senken aufhielt, wurde auf diese Weise auf der Talsohle zusammengetrieben und konnte schließlich unter Einsatz von Pfeil und Bogen sowie Speeren erlegt werden. Dabei blieben die Hunde offenbar nahezu über die gesamte Länge der Jagd angeleint. Auch die Glocken an ihren Halsbändern wurden erst in der letzten Phase der Jagd, unmittelbar vor dem Zugriff auf die Beute aktiviert. Ein vorheriges Läuten verhinderte der Treiber, indem er den Glockenkorpus mit Grasbüscheln verstopfte. Der Graspfropfen konnte dann entnommen werden, sobald der richtige Moment gekommen war.
In einer Publikation von H. Rhese aus dem Jahr 1910 wird darüber hinaus jedoch auch darauf hingewiesen, dass man mit der Jagdmethode bereits zu dieser Zeit nur noch vergleichsweise wenige Tiere erlegen konnte, da das Wild in der Region schon stark dezimiert sei.
Missionar Philip Jakob Heyer, 1807 in Metzingen geboren, erhielt von 1831-1834 seine Ausbildung im Seminar der Rheinischen Mission. Sein Einsatzort sollte Borneo sein, er strandete jedoch 1834 auf Java, wo er sich nur ein Jahr aufhielt, um nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1836 zur Indianermission nach Nordamerika aufbrach. 1837 kehrte er erneut zurück nach Deutschland und schied aus der Mission aus.
Das Kap der guten Hoffnung wurde von vielen Missionaren und Missionsschwestern umsegelt, die ins südliche Afrika oder nach Indonesien reisten. Erst nach der Fertigstellung des Suezkanal konnten Diejenigen, die ihre Missionsarbeit in Ostafrika oder Indonesien beginnen wollten, diesen kürzeren Weg nutzen.
Heyer schreibt 1834 in einem Brief über seine Reise an Bord des Schiffes deNederlanden nach Kapstadt:
„Am 6. August reisten wir … von Amsterdam nach Nieuwendiep ab, wo wir schon Abends so früh auf unserem Schiffe ankamen. … Hier mußten wir nun … noch bis Sonntag den 10. liegen bleiben. Da aber wurden wir mit unserem Schiff vermittelst eines vorgespannten Dampfschiffs von der alten Stelle hinweg in die Zunder-Zee gebracht. … Den 12. aber … wurden die Anker gelichtet … Nach drei Tagen hatten wir schon den sogenannten Canal zwischen Frankreich und England passirt. … Am 15. August Abends sahen wir noch Landsend, das letzte Ende von England … und haben … bis zum 22. nichts Besonderes zu sehen bekommen; an diesem Tag aber … bekamen wir die Insel Madeira zu Gesicht. … Uebrigens geht unser Schiff sehr rasch, was Sie schon daraus ersehen können, daß wir schon den 10. Tag die Insel Madeira und den 11. Palma sahen …
Montag, den 8. Septbr. Wir hatten schon seit einigen Tagen starke Regengüsse. Dieses soll unter und in der Nähe der Linie gewöhnlich sein, und in der Nähe der Sonnenlinie befinden wir uns eben jetzt; denn heute hingen wir ein Stück Holz senkrecht über den Boden und konnten keinen Schatten mehr davon gewahr werden. …
Samstag, den 13. Obschon wir seit einigen Tagen in der Nähe des Aequators umher lavierten: so wurden wir doch diesen Mittag 2 Uhr beim Mittagessen sehr überrascht, als uns der Capitain eine glückliche und schnelle Reise auf der südlichen Halbkugel wünschte. …
Wir haben jetzt seit einige Tagen Süd-Südost-Passatwind; dieser treibt uns zwar sehr rasch vorwärts; doch verursacht die starke Bewegung des Schiffes den drei kranken Geschwistern viel Unangenehmes … Diesen Wind behielten wir bis zum 27ten dieses, bis wohin wir auch nichts Bemerkenswertes erfahren haben. …
Den 23. dieses kamen wir in die Nähe der Insel St. Trinidad … Den 25. Morgens sahen wir in ziemlicher Entfernung, in östlicher Richtung, ein Schiff, das uns den ganzen Tag näher kam. …
Der 5. October. Schon gestern hatten wir … ziemlich günstigen Nord-Wind. … Dienstags Morgens … sahen wir in südöstlicher Richtung ein Schiff in einer Entfernung von 3-4 Meilen, welches in derselben Richtung mit uns segelte. Da aber unser Schiff viel, viel rascher segelt, als jenes: so hatten wir es um 3 ½ Uhr Nachmittags schon eingeholt. … Es war ein englisches Schiff … Von London aus war es schon 72 Tage auf der Reise, und wir nur 56; also ein Beweis, daß die Engländer im Allgemeinen nicht schneller segeln, als die Holländer. …
Mittwoch, den 15. … sahen wir deutlich afrikanisches Land. … Um halb fünf Uhr waren wir schon in der Tafelbai eingelaufen. … Herr Watermeyer nahm uns sehr freundlich auf und erzeigte uns viele Liebe und wir [bekommen] Gelegenheit … nach Franschoek zu fahren. …
Bald werden Sie ausführlichere Nachrichten von uns erhalten. Auch werden wir (Br. Barnstein und ich) wohl, wenn sie diesen Brief lesen, schon zu Batavia auf Java sein, wohin unser Schiff de Nederlanden den 1. Novbr. abfahren soll.“
Ovamboland, Namibia
Anfang 20. Jhd.
Die Waffe kam über den rheinischen Missionar Heinrich Welsch (1875-1927) nach Barmen, der bis 1915 auf den Stationen Omupanda und Omatemba im Norden Namibias arbeitete.
Bereits in dieser Zeit waren Dolche dieser Art nicht nur von Europäern als Reisesouvenirs sehr gefragt, die Nachfrage wurde auch früh von den Herstellern der Waffen bedient. Die Waffen wurden sicher auch aufgrund ihrer Ästhetik geschätzt und somit zur gängigen Handelsware, die von Durchreisenden, Händlern oder vorrübergehend ansässigen Angehörigen der Kolonialverwaltung sowie Missionaren getauscht oder gegen eine Geldsumme erworben werden konnten. Auch heute werden solche Dolche von Schmieden und Schnitzern in Namibia für den touristischen Markt hergestellt. Sowohl in den Tourismusshops der Hauptstadt, als auch in den Verkaufsständen an den Überlandstraßen und in der Nähe touristischer Sehenswürdigkeiten stehen sie zum Verkauf.
Heinrich Welsch könnte die Waffe allerdings durchaus auch als persönliches Geschenk eines ihm besser bekannten Mannes oder eines Gemeindemitglieds erhalten haben. Nicht nur seine lange Aufenthaltsdauer in dem eher begrenzten Umfeld der beiden Stationen, auch der Zustand des Dolchs könnte auf einen zunächst funktionsgemäßen Gebrauch nach der Herstellung und damit auf ein personalisiertes Geschenk hindeuten. Ein Tausch oder Kauf kann jedoch auch nicht ausgeschlossen werden.
Der Dolch ist derzeit ausgestellt in der Sonderausstellung „Zwischen den Welten unterwegs - Reisewege der Mission“, die bis zum 30.06. im Museum auf der Hardt zu sehen ist.
Aus der Bildungsstätte „Augustineum“ der Rheinischen Mission in Okahandja, Namibia, 1930. Das Bild zeigt die Examinierten aus dem Jahr 1932, in der Mitte Missionar Heinrich Vedder.
„Drei Jahre muss fleißig gelernt werden, denn dann kommen die Vertreter der Mission und die Vertreter der Landesregierung zum Examen … 32 junge Männer waren es für diesmal, die sich zum Examen rüsteten … Die letzten Wochen vor dem Examen gelten der Wiederholung. Biblische Geschichte, Katechismus, Sprüche, Sprachkunde, Geschichte des Landes, Naturkunde, Gesundheitskunde, Aufsatz, Schulkunde und Unterrichtskunde – alles wird wiederholt … Schwester Meta Domnowsky, die die Aufgabe hatte, die angehenden Lehrer in die Praxis des Unterrichtens einzuführen, indem sie täglich nachmittags fünf von ihnen in der Gemeindeschule am Unterricht teilnehmen und sie einzelne Lektionen geben ließ, hatte schwer Bedenken, ob es gelingen werde, die jungen Männer im Examen durchzubringen, denn sie sollte in Schulkunde und Unterrichtskunde prüfen. Nur ein halbes Jahr hatte sie seit ihrer Ankunft im Januar Zeit gehabt, diese Fächer zu lehren. Als aber die gefürchteten zwei Tage, der 13. und 14. Juni anbrachen, als die Examenskommission sich am langen Tisch im Schulraum versammelte, als alle Augustineumsschüler … in den Bänken saßen, da ging es gerade in diesen beiden Fächern so hervorragend gut, daß sich Lehrerin und Schüler wunderten und die Kommission sehr zufrieden war.
Aehnlich ging es in den andern Fächern. In der Erdkunde machte sogar der Regierungsvertreter den Vorschlag, nicht mehr die einzelnen zu prüfen, sondern kunterbunt die Fragen zu stellen, und es entstand ein solcher Eifer … daß man ernstlich für die Aufrechterhaltung der Ordnung besorgt sein mußte. Der Regierungsvertreter hatte aber eine solche Freude an der allgemeinen Teilnahme, daß er anordnete: Schreiben Sie querüber, daß alle mit „Gut“ bestanden haben.
Aber nun noch das Rechnen! … Zwei Tage vor dem Examen waren die Aufgaben, die gestellt werden sollten, noch telegraphisch mit der Unterrichtsbehörde vereinbart worden. Sieben Aufgaben wurden gestellt. Von diesen mußten fünf auf Papier ausgerechnet werden …
Nun ging es in den Ausstellungsraum, in dem die Erzeugnisse des Handfertigkeitsunterrichtes ausgestellt waren. Ein richtiger Kaufladen! Weil jeder Lehrer … auch Handfertigkeitsunterricht zu erteilen hat, müssen die Lehrer selbst im Augustineum fleißig an den Nachmittagen ihre Hände üben …
War das eine Freude, als endlich nach der Besichtigung die Glocke ertönte, alle sich im Schulsaal versammelten und nun das Ergebnis bekannt gegeben werden konnte; es ist keiner durchgefallen! Inzwischen hatte die Kommission ihre Sitzung gehabt und beschlossen, wo die Junglehrer ihre Arbeit erhalten sollten. So konnte ihnen denn auch gleichzeitig mitgeteilt werden, wohin sie in den kommenden Tagen abzureisen hätten.
Am Abend fand die Schlußfeier statt. Es galt noch, den Scheidenden ein gutes Wort mit auf den Weg zu geben.“
Solo, Java, Indonesien
Baujahr: ca 2000
Fahrzeuge wie dieses werden in ganz Süd- und Südostasien zum Transport von Fahrgästen eingesetzt.
Je nach kultureller Tradition und ästhetischem Empfinden variieren Bemalung und Formgebung ausschmückender Elemente. Technisch ist das Dreirad-Prinzip einer wahlweise hinter dem Sattel oder vor dem Lenker des Fahrers angebrachten Sitzbank für ein bis zwei Fahrgäste jedoch bei allen Fahrzeugen dieser Art gleich.
In den urbanen Metropolen wie der Hauptstadt Indonesiens, Jakarta, aber auch in größeren Städten der Region, wurden Becaks mit der Zeit vollständig verdrängt.
In kleineren Städten und auf dem Land sind sie aber auch heute im Einsatz und prägen nach wie vor das Straßenbild. Auch handelt es sich um ein für den Kunden vergleichsweise günstiges, quasi öffentliches Personennahverkehrsmittel. Die physische Belastung im teils unübersichtlichen und, je nach Topographie des Ortes, sehr Kraft zehrenden Betrieb ist für den Fahrer (Fahrerinnen sind eher ein seltenes Phänomen) allerdings erheblich. Dennoch bildet das Taxiwesen mit Muskelkraft betriebenen Fahrzeugen ein geregeltes Einkommen für viele Menschen der Region.
Das gezeigte Becak ist in der Dauerausstellung des Museums auf der Hardt zu sehen und wird auch Bestandteil der kommenden Sonderausstellung im Rahmen des Themenjahrs der Bergischen Museen unter dem Motto „Alles in Bewegung“ sein.
Ein Neujahrsgruß aus der Zeitschrift „Der kleine Missionsfreund“, 1922. Eine Zeitschrift der Rheinischen Missionsgesellschaft speziell für die Kinder in der Mission:
„Weit herum wohnen die kleinen Leser, die jeden Monat das Missionsblättchen erhalten. Sie bilden alle zusammen die kleine Missionsgemeinde von Rheinland und Westfalen. Was sage ich? Die kleine Missionsgemeinde? Das ist nicht richtig. Sie ist groß, sogar sehr groß. Denn bei mehr als 90 000 Lesern kehrt allmonatlich der kleine Missionsfreund ein!
Also grüße ich zum Neuen Jahr nicht meine kleine Missionsgemeinde, sondern die große Gemeinde der Kleinen. Und daß ich es gleich sage, was ich ihr wünsche: Wachstum außen und innen! Aus den 90 000 könnten leicht 100 000 werden. Das wäre schön. Wachsen ist stärker werden. Ich denke nämlich so: Die kleinen Leser sind alle Handlanger beim Bau des Gottesreiches durch ihre Liebe und ihre Gaben … Die Mission braucht heute mehr denn je viele helfende Hände. Also wachsen!
Aber auch wachsen innen, wie es vom Jesusknaben heißt, der zunahm an Weisheit und Gnade bei Gott. Wenn eine Pflanze nicht wächst, geht es rückwärts mit ihr. Bei meinen kleinen Freunden aber muß es heißen: Niemals zurück, vorwärts! Wenn der kleine Missionsfreund davon erzählt, wie das Evangelium draußen bei den Heiden wächst, dann möchte er dadurch auch dazu mithelfen, daß es bei uns daheim in den Herzen der kleinen Leute wachse und Gottes Wort eine Macht in ihrem Leben werde. Je mehr die Heiden den Herrn Jesus lieb gewonnen, desto mehr kommen sie von aller Macht der heidnischen Finsternis los. Und je mehr die kleinen Leser daheim den Herrn Jesum liebgewinnen, desto heller wird es auch in ihrem Leben und desto brauchbarer werden sie all zu den Handlangerdiensten im Reiche Gottes.
Gott schenke uns im neuen Jahr viele und brauchbare große und kleine Handlanger für das Werk der Mission!
Dies wünscht von Herzen
Euer Onkel im Missionshaus, G. Mundle“
Gottlob Mundle war von 1920 bis 1935 Missionsinspektor der Rheinischen Mission.
Tansania
20. Jhd.
Diese Darstellung der Heiligen Familie entstand in der Schnitztradition der Makonde, einer Bevölkerungsgruppe im südlichen Tansania und nördlichen Mosambik.
Neben der Schnitzkunst im kulturellen Kontext der Makonde selbst, entwickelten sich Darstellungsformen mit christlicher Thematik historisch zunächst während der Kolonialzeit als Auftragsarbeiten für katholische Missionare, bzw. auf den Missionsstationen oder in deren Umgebung in der Region beiderseits des Flusses Ruvuma. Mittlerweile arbeitet das Gros der Schnitzer jedoch vor allem in den städtischen Zentren und im Umfeld der touristischen Ziele in Tansania und Kenia. Die Bandbreite der dargestellten Themen und ihrer Ausdrucksformen – auch jenseits christlicher Sujets – hat sich im Verlauf der letzten Jahrzehnte ebenfalls erweitert und orientiert sich einerseits an einem internationalen touristischen Markt, erprobt aber auch neue künstlerische Wege.
Während das verwendete Material, afrikanisches Schwarzholz (Dalbergia melanoxylon), für die Makonde-Kunst als allgemein typisch bezeichnet werden kann, ist es die formale Ausführung bei der hier gezeigten Figurengruppe eher nicht. Es handelt sich um ein frei stehendes, halbplastisches Relief, dessen relativ flache Ausarbeitung vermutlich v.a. dem Mangel an Stärke des zunächst vorhandenen Rohlings geschuldet ist. Aber auch wenn das sonst häufig praktizierte, vollplastische Arbeiten hier nicht möglich war, hat der unbekannte Künstler ein ausdrucksstarkes Werk geschaffen. Während Maria und insbesondere Josef sich schützend über dem Kind zu wölben scheinen, trägt dieses kaum kindliche Züge, sondern erinnert in seiner Haltung und Gewandung bereits eher an den jungen Mann, der später mit ausgebreiteten Armen gepredigt haben mag.
Einen Hinweis auf die prekäre Situation, in der sich die Familie laut der biblischen Erzählung befindet, könnte auch die Hintergrundgestaltung liefern. Sie erinnert an einen einfachen Windschutz, eine Decke, ein Laken oder eine Plane, die, an zwei Bäume oder Stangen gebunden, einen gewissen Schutz vor Wind, Regen, Hitze oder Kälte bieten mag. Die sich aufdrängende Assoziation des Motivs ‚Flucht‘ wäre hier auch aus einem anderen Grund plausibel. Für viele der Makonde-Schnitzer ist eine Fluchterfahrung entweder unmittelbarer oder intergenerationaler Bestandteil ihrer Biographie, wenn sie oder ihre Eltern aus dem Norden Mosambiks stammen. Zunächst der Unabhängigkeitskrieg, dann der über Jahrzehnte andauernde Bürgerkrieg waren in der Vergangenheit für viele Makonde Grund für die Entscheidung zur Flucht in das nördliche Nachbarland bzw. die urbanen Zentren Tansanias. Auch aktuell bestehen diese Fluchtgründe wieder, seit die Zivilbevölkerung in der Grenzprovinz Cabo Delgado unter den Gefechten zwischen Aufständischen und mosambikanischer Armee sowie Truppen aus anderen Staaten des östlichen und südlichen Afrika leidet.
Weihnachtsfeier in Mandomai, erzählt von Frau Ella Renken, Ehefrau des Missionars Anton Renken in der Zeitschrift „Der kleine Missionsfreund“, 1905, der Rheinischen Mission. Das Bild zeigt die Kirche in Mandomai, Borneo, Indonesien:
„Das Weihnachtsfest kam näher und näher. Alles wurde eifrig vorbereitet zu einer würdigen Feier des Festes. Die Schulkinder übten fleißig … Aber wo bleibt die Weihnachtskiste aus der lieben deutschen Heimat? Sehnsüchtig schaut man auf der Station darnach aus … Aber die Weihnachtskiste kam nur nicht. Und was besonders fatal war: Die 5 Pakete Christbaumlichte waren auch nicht zur Stelle. Und diese hatten doch nur die verhältnismäßig kurze Reise von Bandjermasin nach Mandomai zu machen.
Was wird es nun mit den verheißenen Röcken, Höschen, Jäckchen usw. werden? Die Schulkinder mußten eben zunächst noch warten helfen auf die Weihnachtskiste. Vielleicht kommt sie doch noch. Und dann tröstete man sie unterdessen damit, daß ja der Herr Jesus und sein Kommen die Hauptsache am Weihnachtsfest sei … Aber im Stillen rechneten sie doch immer noch mit der Kiste und schauten fleißig nach dem Ruderboot aus.
Endlich kam der heilige Abend. In der Kirche war alles zugerichtet worden. Auf dem Altar stand der Tannenbaum. Dieser stammte nicht aus dem Wald, sondern aus einer deutschen Fabrik, und zwar hier aus der Nähe von Barmen. Die Dajakken nennen den künstlich einer deutschen Tanne nachgemachten Fremdling: batang klawa oder batang umbo d.h. Lichterbaum. In diesem Jahr verdiente er freilich kaum den Namen: nur 5 Lichter schmückten ihn. So viele waren aus dem vorigen Jahre noch übrig geblieben … Aber er war und blieb in Dunkel gehüllt, nur die Spitze strahlte im Glanz der fünf Lichter. Aber dennoch waren aller Augen auf den Baum gerichtet. Langsam drehte er sich auf seinem Fuß, wie von unsichtbaren Händen in Bewegung gesetzt …
Vor dem Lichterbaum, zu beiden Seiten des Altars, waren die bekannten Gruppen aufgestellt: rechts Bethlehem, der Stall, die Krippe, die Eltern und das Kind Jesus, davor die anbetenden Hirten; von ferne her kommen die Weisen aus dem Morgenlande mit Pferd, Kamel und Elefant; links breitet sich das Feld mit den Hirten und ihren Herden aus. Etwas erhöht erblickt man den Engel der Verkündigung; auch eine Quelle mit Springbrunnen fehlt nicht. Der ganze Aufbau ist mit Bananenblättern bedeckt und mit Moos belegt, das die Schulkinder auf den Palmbäumen gesucht haben …
Bis zum Epiphanien-Sonntag bleiben die Gruppen in der Kirche stehen, und wer auf die Station kommt, Mohammedaner oder Heide, wird in die Kirche geführt und darf sich alles besehen.
Nach der gemeinsamen Feier sollte die Bescherung für die Kinder stattfinden. Aber die Weihnachtskiste war ja ausgeblieben! Allerdings. Dennoch gab es eine Ueberraschung. Liebe Sonntagsschulkinder in der deutschen Heimat hatten den Dajakken-Kindern in Mandomai als Gruß zum Weihnachtsfeste biblische Bilder geschenkt, und dieses Paket war richtig mit der Freitagabendpost noch angekommen, am 23. Dezember! Nun war die Freude groß …
Als das neue Jahr erschien, so richtete man sich in Mandomai darauf ein, die Jahreskonferenz der Rheinischen Missionare aufzunehmen … Aber als die Missionarsfrau von Mandomai nach Bandjermasin kam … fand sie unter anderem … auch die verirrte Kiste. Da wurde denn am 1. Sonntag nach Epiphanias noch einmal Christfest gefeiert. Jetzt wurde der Christbaum ganz anders geschmückt als zuvor … Die Kinder hatten erst morgens im Vormittagsgottesdienst etwas von der bevorstehenden Extrafeier erfahren. Groß war ihre Verwunderung, als sie alle noch ein Kleidungsstück erhielten … So hell und freudig wie an diesem Abend hatte nie das „Ehre sei Gott in der Höhe“ geklungen.“
Von Ostasien bis zum Odenwald: ganz unterschiedliche Materialien, Traditionen, kulturelle Kontexte und Ästhetik prägen die Krippendarstellungen in Afrika, Asien, Europa und Lateinamerika. Gemeinsam ist ihnen das Thema des Weihnachtsgeschehens.
Neben besonders ausdrucksstarken Krippendarstellungen in der Tradition der Makonde-Schnitzerei Tansanias, zeigt die Schau auch Krippen aus Privatbesitz. Mit ihnen verbinden sich oft ganz persönliche Geschichten rund um die Weihnachtszeit.
Zu einem vorweihnachtlichen Besuch laden wir Sie herzlich ein.
Öffnungszeiten: Sonntags von 14-17Uhr, Di.-Do. nur nach Vereinbarung
Museum auf der Hardt
der Archiv- und Museumsstiftung der VEM
Missionsstraße 9
42285 Wuppertal
museum@vemission.org
Bitte beachten Sie: zum Schutz vor Ansteckung mit dem Corona-Virus gilt für den Besuch die 2G-Regel und das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung.
Am Mittwoch, 27. Oktober 2021, kamen die Vertreterinnen und Vertreter der größten Kooperation von Museen im Bergischen Land wieder persönlich im Stadtmuseum Langenfeld zusammen.
Neben dem Austausch über den aktuellen Stand der Museumsarbeit in den teilnehmenden Häusern stand das gemeinsame Themenjahr im Fokus, das aufgrund des verspäteten Starts bis Juni 2022 verlängert werden konnte. Unter dem Motto „Alles in Bewegung“ bieten die Museen unter anderem Sonderausstellungen, Vorträge und Aktionstage an. Zum Programm gehören außerdem geführte Rad- und Wandertouren, die Ausstellungsbesuch, Naturerlebnis und Bewegung auf einzigartige Weise verbinden. Sie erfreuten sich in diesem Jahr großer Beliebtheit und sollen ab Frühjahr 2022 fortgesetzt werden. Alle aktuellen Informationen finden Sie auf der Webseite www.bergischemuseen.de.
Begeistert von den Früchten der bisherigen Zusammenarbeit und der großen Resonanz planen die Museen bereits für 2023 ein drittes Themenjahr mit dem Arbeitstitel „Alles in Verbindung“. Auch hier hoffen die Museumsvertreterinnen und -vertreter auf die Unterstützung der öffentlichen Hand, um dieses Vorhaben realisieren und neue, vielfältige Erlebnisse im Bergischen Land anbieten zu können.
Das Netzwerk Bergische Museen startete im Sommer 2019 mit 11 teilnehmenden Museen, darunter auch das Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM in Wuppertal. Inzwischen ist der aktive Kreis auf 21 Museen angewachsen. Gleichzeitig intensivieren sich die Partnerschaften zu Tourismusverbänden und anderen Organisation und Initiativen in der Region und darüber hinaus. Das aktuelle Themenjahr wird ermöglicht durch die finanzielle Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, des Landschaftsverbands Rheinland sowie von acht Träger- und Fördervereinen Bergischer Museen.
Weitere Informationen:
Dr. Katrin Hieke
Geschäftsstelle AK Bergische Museen
c/o Museum und Forum Schloss Homburg
Tel. 02293 910122
info[at]bergischemuseen.de
20. Jhd.
Wenn sich die Männer der Volksgruppe der Yali im zentralen Hochland der Insel Neuguinea in kriegerische Auseinandersetzungen begaben, war diese Schutzkleidung bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts ein häufig verwendeter Bestandteil ihrer Ausrüstung.
Die Panzerung aus engmaschig geknüpften, harten Rotangfasern umschließt den Oberkörper nahezu vollständig. Brust, Bauch, Flanken und Rücken des Trägers sollten so vor Verletzungen während der Kampfhandlungen geschützt werden.
Zwar erweist sich dieser Schutz als wenig wirkungsvoll, wenn Blankwaffen aus geschmiedetem Metall oder Handfeuerwaffen zum Einsatz kommen. Doch der Einsatz solcher Waffen durch einen Gegner war für die Yali bis in die 1960er Jahre hinein kaum zu erwarten. Denn potentielle Gegner kamen entweder aus den eigenen Reihen oder verfügten als Angehörige benachbarter Gruppen in der Region lediglich über ein eingeschränktes Arsenal an Angriffswaffen. Es handelte sich dabei um Hieb-, Stich- oder Schlagwaffen aus Holz, teils in Verbindung mit entsprechend zugespitzten Steinklingen oder Steinen, die als Keulenköpfe ausgearbeitet waren. Auch entsprechend bearbeitete Knochen und Knochenteile wurden verwendet.
Die relativ nah an die Gegenwart heranreichende Situation einer solchen Waffengleichheit zwischen potentiellen Gegnern in einer kriegerischen Auseinandersetzung ist ganz wesentlich der isolierenden Wirkung der schroffen Topographie des zentralen Berglandes auf Neuguinea geschuldet. Sie erschwerte in den vergangenen Jahrhunderten den kulturellen Austausch und die Begegnung der Yali mit Menschen außerhalb der eigenen Wohngebiete erheblich. Einige der in anderen Teilen der Welt - v.a. aber später von den industrialisierten Gesellschaften - genutzten Techniken und Materialien waren den Yali bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts daher praktisch unbekannt. Dies galt insbesondere für die Verhüttung und Weiterverarbeitung von Metall. Im benachbarten Südostasien dagegen, wurde es zunächst zur Herstellung von Schmuck und Gebrauchsgegenständen und später auch von Waffen bereits seit mehr als zwei Jahrtausenden verwendet.
Die erste Begegnung der Menschen in der Region von Angguruk mit Europäern fand erst 1960 statt. Ihre Gegenüber waren damals zwei Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft.
Heute sind die Menschen in der Region über moderne Kommunikationsmittel und das Internet mit der Welt vernetzt. Vor allem junge Menschen verlassen aber auch das Hochland, um in den städtischen Zentren, in Indonesien oder im Ausland eine Ausbildung oder ein Studium zu absolvieren, wenn sie die Möglichkeit dazu erhalten. Denn die Defizite für Yali und andere Papua in der Westhälfte der Insel hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen und ökonomischen Perspektiven sowie der kulturellen Entfaltungsmöglichkeiten haben in der Gegenwart weniger topographische als vielmehr politische Gründe. Eine Autonomie oder Unabhängigkeit, die diese Perspektiven und Entfaltungsmöglichkeiten realistisch erscheinen ließen, wurde den Menschen der Region zu keiner Zeit zugestanden. Indonesien hatte stattdessen die Inselhälfte 1969 unter fragwürdigen Umständen ihrem Staatsgebiet einverleibt, für deren Einwohner aber kaum Schritte in eine entsprechende Richtung ermöglicht.
Die Sarepta-Schwester Leonie Letzner war 16 Jahre für die Bethel-Mission in Tansania als Diakonisse, Krankenschwester, Lehrerin und Hebamme tätig. Die meiste Zeit arbeitete sie für das Krankenhaus in Bumbuli.
Leonie Letzner wurde im April 1955 eingesegnet und am 2. Oktober 1957 ausgesandt.
Über ihre Anfänge berichtete sie unter anderem in den Nachrichten aus der Bethel-Mission.
Dort schreibt sie 1968: „Ein Rundgang durch Bumbuli: Vom Schwesternhaus zur Hospitalkapelle geht man etwa drei Minuten. … Durch den offenen Rundbogen des Schwesternhauses, ohne Tür, der nach draußen führt, schweift der Blick über das gegenüberliegenden Doktorhaus auf die Berge weit in der Runde. … Rechter Hand, neben dem Büro, ist die Hospital-Waschküche, sozusagen im Freien. … Bevor ich durch das Gattertor das eigentliche Hospitalgelände betrete, sehe ich zur Linken die „Pharmacie“, ein kleines Gebäude, in dem die Arzneimittel aufbewahrt werden. … Zur Rechten liegen die Apotheke und die Räume für die Außenpatienten. Der Dienst an den Außenpatienten wird von drei Heilgehilfen mit den Namen Hezekia, Salomo und Ismaeli und einem afrikanischen Hilfsarzt versehen. … An das letztere Gebäude schließt sich der Operationssaal mit dem Sterilisierungsraum an. Demgegenüber finden wir ein kleines Haus, die Entbindungsstation. … Bevor ich nun die wenigen Stufen heruntergehe vorbei an dem Hause der Frauenstation, werfe ich noch einen Blick nach rechts, wo sich, in Stufen abwärts dem Tale zu, noch verschiedene Hospitalgebäude befinden wie: Schule und Wohnhaus der Studenten und die Tischlerei. … Ich gehe nun gerade auf die Hospitalküche zu, die nach zwei Stufen hin offen ist … An der rechten Seite liegt das Männerhaus. … Inzwischen bin ich nun bei der Kapelle angelangt, die einige Treppenstufen höher liegt. Gleich dahinter liegt das kleine Haus für Massai. … Die Kapelle ist eine nach vorn hin offene Halle. In der Andacht wechseln sich ab: Der Eingeborenen-Pastor, der Evangelist, ein Heilgehilfe oder auch ein Student. Hier wird nur Suaheli gesprochen. Beim Ausgang aus der Kapelle trifft der Blick auf die Häuser der Inder, Araber und das Haus der Angehörigen der Kranken. … Auf dem Rückwege versammeln sich Schwestern und Heilgehilfen noch einmal in dem kleinen Raum des Männerhauses, in dem ich donnerstags mit der Eingeborenen-Hebamme die Mütterberatung abhalte. … Einer der Mitarbeiter spricht dann den Morgensegen, danach gehen alle an ihre Tagesarbeit.“
Das Bumbuli Lutheran Krankenhaus existiert heute noch unter der Leitung der ELCT-NED.
Zuletzt unterstützte die VEM zwei Kleinprojekte in Bumbuli, den Ankauf einer Industriewaschmaschine sowie Renovierungen am Krankenhaus.
Kamerun
Zweite Hälfte 1990er Jahre
Die Straßen in der Region Extrême Nord im nördlichsten Zipfel Kameruns sind außerhalb der größeren Städte und Siedlungen meist schlecht oder gar nicht befestigt. Wer nicht zu Fuß oder mit einem Last- oder Reittier unterwegs ist, statt dessen größere Distanzen in vergleichsweise kurzer Zeit zurücklegen will oder muss, der benötigt bevorzugt entweder einen Geländewagen oder ein Motorrad. Dies ist besonders im Gebiet der Mandaraberge nördlich des Regionalverwaltungssitzes Marua der Fall. Sowohl dort als auch in der Stadt selbst sind robuste Motorräder - wie das hier als nahezu maßstabsgetreues Modell zu sehende - als Lastentransporter oder Personentaxi häufig im Einsatz. Auf eine solche Einsatzmöglichkeit weisen die als Doppelsitzer ausgeführte Sitzfläche und die Verschalung des Hinterrades am Modell hin.
Das Modell selbst ist ein kleines Kunstwerk und wurde aus einem organischen Material hergestellt, das in der Landwirtschaft der gesamten Sudanzone Afrikas zwischen tropischer Regenwaldzone und Sahara in großen Mengen anfällt. Es handelt sich um die Stängel und Fasern des Sorghum. Die Körner dieser Hirseart sind in den halbtrockenen bis trockenen Gebieten Afrikas ein Grundnahrungsmittel. Auch im Norden Kameruns wird Sorghum daher häufig angebaut. Stängel und Blätter der Pflanze können als Viehfutter verwendet werden. Aufgrund ihres hohen Zellulosegehalts sind sie jedoch auch als stabilisierende Beimischung zu Dung und Lehm bei der Herstellung der Wände traditioneller Häuser in der Region geeignet.
Dieselbe Stabilität ist es aber auch, die sie zum Ausgangsmaterial für kreatives Arbeiten macht. Modelle wie dieses werden so oder in einfacheren Ausführungen als Spielzeug, oder gezielt für den (touristischen) Markt hergestellt. Das hier zu sehende Motorradmodell wurde 1998 in der Nähe des Dorfes Oudjilla erstanden.
Die Rheinische Mission nutzte von Beginn ihrer Arbeit Bilder und Drucksachen zur Vorstellung ihrer Arbeit. Neben persönlichen und amtlichen Briefen an die Missionsleitung, schrieben die Missionare und Schwestern Berichte an die Heimat, die in den Berichten der Rheinischen Mission veröffentlicht wurden.
Auch Bibeln und andere Publikationen veröffentlichte die Mission. In einzelnen Regionen etablierte die Rheinische Mission daher auch eigene Buchpressen, für ihre eigene Arbeit aber auch für Aufträge von außen.
Der Missionar Carl Heinrich Dietrich, ausgebildeter Buchdrucker, war von 1851 bis 1870 für die Rheinische Mission in Banjarmasin, Borneo, Indonesien tätig.
1858 berichtet er über die Arbeit an und mit der Missionspresse in Banjarmasin.
„In der Dämmerung, etwa ½ 6, stehe ich auf, kleide mich an … um 6 wird bei Geschw. Barnstein gefrühstückt, zu welchen ich dann hinübergehe. Unterdessen versammeln sich allmählich die drei auf der Druckerei arbeitenden Leute, da um ½ 7 Uhr die Arbeitsstätte geöffnet wird … Dann beginnt unsere Arbeit, der eine etwa am Schriftkasten, der andere mit seinem Gespan an der Presse, und ein vierter wohl am Buchbindertisch, so wie es gerade die Nothwendigkeit erheischt; zuweilen müssen auch wohl alle an´s Bücherbinden, denn die Buchbinderei spielt noch die größte Rolle mit bei uns - So geht es denn, außer etwa ¼ Stunde Mittagessen, anhaltend fort bis Nachmittags 3 Uhr, weil dann unsere Arbeitszeit beendet ist …
Wir haben jetzt viel Arbeit. Für Emde zu Surabaya haben wir vor einiger Zeit ein Werkchen in klein Sedezformat, 552 Seiten stark, beendet, und müssen jetzt die Bücher einbinden. Für die Pulopetaker Conferenz habe ich jetzt die neue Auflage des Katechismus und der Lieder mit Gebeten in Arbeit. Auflage 2500 Exemplare … Außerdem will Emde das gedruckte Buch auch in Malaiisch und Javanisch übersetzen und dann drucken lassen.“
Missionar Dietrich hätte die Missionsdruckerei lieber an einem anderen Ort aufgebaut, was aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich war.
„In mancher Hinsicht habe ich später schon mehrere Male gedacht, es wäre nicht übel gewesen, wenn unsere Presse unter den Dajakken aufgestellt worden wäre; ich würde dort eher mit Schulkenntnissen versehene Jünglinge selbst von freien Dajakken haben bekommen können … Ferner sind da doch auch nicht so viele Gelegenheiten zur Verleitung der jungen Leute … ich muß gestehen, wenn nicht pecuniäre, gesetzliche und andere Rücksichten mich zurückhielten, würde ich noch wohl den Antrag zur Versetzung stellen wollen … [Außerdem] hängt es dem neuen Preßgesetze zufolge vom Residenten ab, zu bestimmen, wo die Presse ihren Verbleib haben muß.“
Die Missionspresse in Banjermasin war eine von dreien im Missionsgebiet der Rheinischen Mission in Indonesien.
Das Bild zeigt die Druckerei in Laguboti auf Sumatra, Indonesien.
Botswana
zweite Hälfte 20. Jhd.
Mit einer Länge von etwa 55 Zentimetern und einem Durchmesser von eineinhalb Zentimetern ist dieser entrindete und an seinem vorderen Ende durch einen präzisen Anschnitt zugespitzte Ast aus hartem Holz ein denkbar einfach gearbeitetes Werkzeug.
Doch trotz der Einfachheit, handelt es sich um ein effizientes Arbeitsgerät, das sich in seiner Einsatzweise über einen langen Zeitraum praktisch nicht verändert hat. Vermutlich schon vor mindestens 10.000 Jahren wurden Grabstöcke dieser Art im gesamten südlichen Afrika benutzt. Sie wurden von Jäger- und Sammlergemeinschaften in der klimatisch überwiegend halbtrockenen bis trockenen Region für das Ausgraben und Sammeln von essbaren Pflanzen, bzw. deren unterirdisch wachsenden Teilen eingesetzt. Denn es sind häufig Wurzelknollen und Rhizome, die aufgrund der Speicherkapazität ihres Gewebes viel Wasser enthalten. Nicht zuletzt lassen sich einigen Pflanzenbestandteilen medizinische Wirkungen zuschreiben.
Das nahezu umfassende Wissen um diese Aspekte des Gebrauchs von Wildpflanzen konzentrierte und konzentriert sich teils bis heute – jenseits der männlich besetzten Tätigkeit des Jagens – bei den Frauen. Sie sind es damit auch, die den Grabstock als ein Werkzeug des Nahrungserwerbs mit sich führen und ihn an den richtigen Stellen und auf effektive Weise einzusetzen wissen. Da nicht viel Material zur Herstellung des Werkzeugs nötig und die Zurichtung für den Zweck leicht zu bewerkstelligen ist, kann der Grabstock bei Verlust auch relativ schnell ersetzt werden. Damit ist er in gewisser Weise typisch für die sehr reduzierte materielle Kultur, die allen Gesellschaften eigen ist, welche ein weitgehend nicht sesshaftes Leben, jenseits von Betätigungen wie Ackerbau und Nutzierhaltung führen.
Historisch galten die Angehörigen der Jäger- und Sammlergemeinschaften den ins südliche Afrika erst später einwandernden viehhaltenden und ackerbauenden Gruppen nicht selten als rückständig und primitiv.
Diese Einstellung konnte bis zu einer Haltung führen, die den Jägern und Sammlerinnen das ‚Menschsein als solches‘ rundweg absprach. Auch die kolonial ambitionierten Europäer und Europäerinnen, die im Zuge der Expansion europäischer Mächte im 18. und 19. Jahrhundert ins südliche Afrika kamen, teilten diese Auffassung mitunter.
Die nahezu zwangsläufige Folge war die zunehmende Verdrängung der Jäger und Sammlerinnen von dem Land, das sie für Ihre Art des Lebens und Wirtschaftens benötigten. Vertreibungen, Ausbeutung bis hin zu Versklavung und willkürlicher Ermordung Einzelner oder ganzer Gruppen sind dokumentiert.
Die Ausbeutung ihrer Kenntnisse und Fähigkeiten – wie beispielsweise das Wissen um das Fährtenlesen unter den männlichen Angehörigen dieser Gruppen – reicht dabei nahe an die Gegenwart heran. Als Späher und Scouts wurden sie im Kolonialkrieg Portugals gegen Einheiten der angolanischen Unabhängigkeitsbewegungen in den 1970er Jahren eingesetzt. Auch das südafrikanische Militär bediente sich der Männer bei Operationen gegen den militärischen Arm der namibischen Unabhängigkeitsbewegung SWAPO. Aus dieser Epoche nachwirkende Ressentiments gegenüber den Angehörigen der Gemeinschaften bestehen bis in die Gegenwart bei Teilen der ehemaligen Unabhängigkeitsbewegung, die heute den Staat politisch dominiert.
Eine Lebensweise, in der das Sammeln von Wildpflanzen und -früchten noch heute eine gewisse, substantiell zur Lebenshaltung beitragende Rolle spielt, ist praktisch nur noch in einigen Randgebieten der Halbwüstenzonen der Kalahari im zentralen Teil des südlichen Afrikas möglich.
Der rheinische Missionar Friedrich Wilhelm Weber berichtet über die Entwicklungen bis zur Einweihung der Kirche am 21. November 1878.
Über den Bau in seiner letzten Phase:
„Mitte August reisete ich nach Steinkopf, um die Verladung der übrigen Kirchensachen, galvanisiertes Eisen, Bänke ec. zu leiten. Ende August kam ich wieder hier [Warmbad] an … Ich zog eine blaue Hose und Wams an, nahm Hammer und Kelle in die Hand und fing mit 2-3 Leuten im Inneren des Gebäudes die Arbeit an. Mancher Schweißtropfen ist da von der Stirne gefallen, die Arbeit wurde aber leicht, weil sie mit Freuden geschah … Noch war viel zu tun … Die Chorkammer, deren Mauern erst 4 Fuß hoch waren, mußten noch aufgebaut werden. Um schneller zum Ziele zu kommen, ließ ich 6-7000 Stück Luftsteine machen und baute damit die Sacristei auf. Die Kirche selber ist ganz von Bruchsteinen gebaut …
`Bauen kostet Geld´, Ja, viel mehr als ich´s ahnte und dachte. Gerade weil die Mittel dazu aus dem Verkauf eines beträchtlichen Stück Landes geflossen waren, war der Kirchbau in mancher Hinsicht erschwert und kostspielig geworden … Zudem zeigte sich auch Zweifel und Muthlosigkeit, selbst Feindschaft. Die schwer anhaltende Dürre legte sich auch recht fühlbar auf die Gemüther. Da kam uns der Herr Ende September mit Seiner Hülfe entgegen, indem Er uns einen ½ Stunde dauernden Regenschauer sandte. Damit war vorläufig der ersten Noth abgeholfen. Je mehr es aber der Vollendung zuging, desto mehr schwanden diese Hindernisse, Vertrauen und auch allmähliche Freude brachen sich Bahn … Immerhin hat die Gemeinde manche Opfer gebracht und bringen müssen …
Die Kirche liegt auf einer freien, erhabenen Stelle und kann von allen Seiten gesehen werden. Sie ist 80´ lang und 30´ breit und im gothischen Styl gebaut, d.h. bezüglich der Türen und Fenster … Der Turm besteht aus drei Stockwerken … hier hängen die Glocken, welche durch drei kleine Schallfenster ihren Klang entsenden. Der Thurm ist mit der Spitze ungefähr 45´ hoch. Derselbe hätte höher sein müssen, allein es fehlte an dem nöthigen Material zum Gerüst … Das Dach, welches die Form eines stumpfen Winkels hat, ist mit galvanisierten Eisenplatten gedeckt … Zu beiden Seiten sind die Kirchenbänke, je 20, aufgestellt und füllen, da sie absichtlich ein wenig weit auseinander stehen, den ganzen Raum des Schiffes aus. Vor uns in der Mitte zwischen zwei Thüren, welche in die Chorkammer münden, steht der Altar. Ueber demselben ist eine Nische angebracht … Sobald das Marmorkreuz aus Barmen kommt, ein Geschenk von Freunden aus Wupperfeld, soll es am Fuße der Nische seine Stelle finden … Die Kirche fast über 300 Menschen.“
Einweihung
Zur Einweihung kamen viele Missionare, deren Ehefrauen, Schwestern und Gemeindemitglieder aus dem Umland. „Als der Morgen anbrach, sah man überall die Leute in Bewegung, die Festkleider wurden angelegt, in kleinen Gruppen ließen sich die Leute vor der Kirche nieder und harrten mit Spannung auf das Zeichen zum Anfang. Da, um 9 Uhr, rief das kleine Glöcklein die festfeiernde Schaar zur alten Kirche, in welcher zum letzten Male der Gottesdienst gehalten werden sollte … Dann verließen wir das alte Haus mit dem Gesang: `Unsern Ausgang segne Gott.´ Die Missionare nahmen die heiligen Gefäße vom Altar, die Bibel, Agende und Gesangbuch, den Zug eröffnend. Ihnen folgten die weißen Leute, dann die Aeltesten, der Häuptling mit seinen Rathsleuten und dann die ganze Gemeinde. Unter dem Geläute der Glocken zogen wir hinauf zum neuen Gotteshause … Nachdem Alle ihren Platz gefunden hatten, trat Bruder Rath von Bethanien vor den Altar und vollzog die Weihe des Hauses … Der Gottesdienst hatte Alles in Allem drei Stunden gedauert.“
Die erste Kirche war von den Wesleyaner Missionaren um 1810 erbaut worden, die Rheinische Mission übernahm die Station Warmbad 1867. Die Kirche steht noch heute.
Indonesien
vor 1922
(aus dem Nachlass von Wilhelm Spieker)
„Herzlichen Dank sagen wir der geehrten Deputation für die Erlaubnis zur Erholung nach Deutschland kommen zu dürfen. Schwer genug ist es uns geworden die Arbeit zu verlassen und noch schwerer wird es uns wohl werden, uns in die deutschen Verhältnisse wieder einzuleben. Doch es muß sein. Mein Gesundheitszustand geht auf und ab. Habe mehr Zeiten wo asthmatische Leiden mich sehr plagen, als wo ich frei davon bin.“
So beginnt Missionar Wilhelm Spieker seinen Brief vom 21. März 1922 aus dem damaligen Niederländisch-Ostindien an die Leitung des Missionshauses der Rheinischen Missionsgesellschaft in Barmen. Seine Frau und er werden wenige Wochen später von Padang auf Sumatra die Heimreise antreten und nicht mehr auf den indonesischen Archipel zurückkehren. Verlassen hatten die beiden Deutschland 16 bzw. 17 Jahre zuvor, um zunächst auf den Sumatra vorgelagerten Inseln von Mentawai, später dann auf Sumatra selbst ihren Dienst auf den Missionsstationen von Sikakap bzw. Tampahan zu versehen.
Wenn Wilhelm Spieker sich in seinem Brief auf „die deutschen Verhältnisse“ bezieht, meinte er zum einen sicher das alltägliche Leben in der alten Heimat und die Routinen einer hiesigen Pfarrstelle, auf die er nach seiner Rückkehr schließlich versetzt war. Beides wird sich sehr von dem Leben der Eheleute in Indonesien unterschieden haben. Das gilt insbesondere für ihre Zeit auf dem noch heute vergleichsweise abgelegenen Archipel von Mentawai, der Europäern vor gut einhundert Jahren zunächst sehr fremd und isoliert vorgekommen sein mag. Doch es waren auch politisch und gesellschaftlich ganz andere Verhältnisse in die das Ehepaar zurückkehrte. Aufgebrochen waren sie aus einem Kaiserreich auf dem Höhepunkt seiner imperialen Ambitionen und maximalen kolonialen Expansion. Zurück kehrten sie in eine Republik, die nach der Katastrophe des Krieges, der umfassenden Niederlage und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch alles andere als ein Hort der politischen und gesellschaftlichen Stabilität war.
Vor diesem Hintergrund mögen die hier zu sehenden Gegenstände, die die Spiekers aus Südostasien nach Deutschland mitbrachten, in mehrfacher Hinsicht als Repräsentanten einer anderen Welt und Lebenswirklichkeit erscheinen. Und dennoch sind sie unmittelbar und ganz speziell mit dem Leben von Europäern und Europäerinnen im damaligen Niederländisch-Ostindien verbunden.
Die Serviettenringe sind rein von ihrer Funktion her betrachtet einem europäischen kulturellen Kontext zuzuordnen. Sie sind - sehr wahrscheinlich von Indonesierinnen - für europäische Abnehmer und nach deren Geschmack gefertigt. Gleichzeitig verweisen sie jedoch auf die handwerklichen Traditionen und künstlerische Ästhetik der Menschen, die sie herstellten.
Das Teebesteck lässt sich zunächst vor einem ähnlichen Hintergrund betrachten. Aber jenseits seiner Funktionalität verweist es in seinen vordergründig dekorativen Elementen auf wesentliche Aspekte der kulturellen Identität der Bewohner des Inselreichs. Den Abschluss der Löffelstiele bilden stilisierte Schattenspielfiguren des javanischen Wayang Kulit. Der Boden des flachen Tellerchens zeigt das geflügelte Pferd Kuda Sembrani, das von einer umlaufenden Girlande aus Lotosblüten umgeben ist. Dieses Wesen ist fester Bestandteil der Mythologie des malaiischen Archipels.
Beide Darstellungen verweisen auf ein hinduistisch beeinflusstes Erbe und somit auf jenen Strang der kulturellen Wurzeln, der auf den indischen Subkontinent führt. Historisch reicht diese Prägung der Region weit länger zurück, als die Beeinflussung durch die europäische Kolonialmacht. Und bis heute erfreut sich Kuda Sembrani großer Beliebtheit, wohl nicht zuletzt, da sein herausragender Charakterzug der Mut bzw. die Tapferkeit ist.
Das Bild zeigt einen Stundenplan des Missionsseminars aus dem Jahr 1828.
Das Barmer Missionsseminar wurde zunächst als Vorschule gegründet, um mit den zahlreichen Anfragen zum Missionsdienst umzugehen. Bereits 1827 wurde sie in ein Seminar umgewandelt mit dem Ziel „Schullehrer für die Heidenwelt“ auszubilden.
Das Ziel der Ausbildung verschob sich, als die Rheinische Missionsgesellschaft das Seminar als ihr eigenes übernahm. Inspektor Leipoldt erläuterte in einem der ersten Berichte die Veränderungen des Seminars: „Diese neue Stellung legte dieser Anstalt die Verpflichtung auf, allen Anforderungen der verbundenen Gesellschaften für die Bildung ihrer Sendboten zu entsprechen.“
Im Laufe seiner 150jährigen Geschichte durchlief das Seminar verschiedene Reformen. So wurde beispielsweise die Studienzeit von drei im Jahr 1858 auf vier Jahre verlängert. Latein, Griechisch und Hebräisch wurden zu obligatorischen Fächern. Der Grund hierfür war: „Es hatte sich … herausgestellt, dass unsere Missionare unter den Naman und Ovaherero, unter den Dajacken, Malaien und Chinesen imstande sein mußten, die Bibel in die heidnischen Sprachen zu übertragen, also selber den Grundtext verstehen mußten.“
Seinen Tiefstand hatte das Seminar 1923 mit 24 Schülern. Die Zukunft der Rheinischen Mission war unsicher und man hielt sich mit Neuaufnahmen zurück. 1926 wurde die Ausbildung auf sieben Jahre verlängert. Es wurden Abkommen mit anderen Missionsgesellschaften geschlossen, Schüler aus den Missionen aufzunehmen und auszubilden. Die Jahre 1926-1930 waren die am stärksten belegten Jahre mit 95 Auszubildenden.
Nach dem zweiten Weltkrieg wurde der Seminarplan erneut geändert. Die Kirchliche Hochschule siedelte sich auf dem „Heiligen Berg“ in unmittelbarer Nachbarschaft zum Seminar an. Latein und Griechisch, die zwischenzeitlich vom Lehrplan gestrichen worden waren, wurden wieder aufgenommen. Schüler hatten nun die Möglichkeit, ihre Seminarzeit durch einige Semester an der theologischen Fakultät zu studieren. Nach dem Abschluss folgten ab 1961 ein Vikariat und schließlich das 2 theologische Examen, „das nach einer mit der Rheinischen Mission verbundenen Kirchen geschlossenen Vereinbarung den Missionaren, wenn sie nach zwei Arbeitsperioden … in die Heimat zurückkehrten, die Möglichkeit zum Übergang in den kirchlichen Dienst eröffnete.“
Wie offen sich das Seminar präsentierte zeigt, dass auch Auslandspfarrer im Seminar ausgebildet wurden. Verschiedene Vereine und Comités nutzten die Möglichkeit des Seminars zur Ausbildung ihrer Pfarrer für den Auslandsdienst. So wurden z.B. bis 1893 89 Pfarrer nach Nordamerika entsandt.
„Auf diese Weise wurde die Mischung der Bewohner des Missionshauses immer stärker. In den Arbeitsstuben, Lehrsälen und Schlafzimmern fand man nicht bloß junge Männer aus allen Provinzen … sondern aus Rußland, aus England, aus Nordamerika, aus Griechenland und Kleinasien trafen sie hier zum Lernen und Arbeiten, zur Vorbereitung … zusammen.“
Die Entwicklung, dass mehr und mehr einheimische Pfarrer die Europäer ablösten, brachte die Frage mit sich, inwieweit das Seminar fortbestehen sollte. Nach Gesprächen und Verhandlungen mit den mit der Rheinischen Mission verbundenen Kirchen entschied die Missionsleitung, dass Seminar aufzulösen. Das letzte Examen fand 1975, nach 150 Jahren Existenz, statt.
Die in den tropischen und gemäßigten Ozeanen weltweit vorkommenden Meerestiere der Gattung Hippocampus gehören zu den Knochenfischen und somit zu einer der ältesten heute noch existierenden Lebensformen des Tierreichs.
Ihr merkwürdiges, die Phantasie des Menschen anregendes Aussehen mag nicht nur ein Grund für ihren Eingang bereits in die griechische Mythologie gewesen sein. In Ost- und Südostasien mag es auch dazu beigetragen haben, den Tieren seit jeher heilende Wirkung zuzuschreiben und sie zu medizinischen Zwecken zu verarbeiten. Damit sind Seepferdchen eine von geschätzt etwa 1500 Tierarten bzw. Gattungen, deren Bestandteile in der traditionellen chinesischen Medizin (auch als TCM abgekürzt) Verwendung finden. Getrocknet, zu Pulver zermahlen und teils zusammen mit weiteren tierischen oder pflanzlichen Bestandteilen in Pillen gepresst, sollen sie unter anderem gegen Atemwegserkrankungen und Abszesse, aber auch potenzsteigernd wirken.
Trotz mittlerweile bestehender, internationaler Handelsbeschränkungen sind praktisch alle Seepferdchenarten in ihrem Bestand gefährdet, was auf Umwelteinflüsse, klimatische Veränderungen und nicht zuletzt auch auf die enorme Nachfrage auf dem ostasiatischen Markt und insbesondere in China zurückzuführen ist.
In der westlichen Medizin waren die TCM, ihre theoretische Basis, resultierende Heilungsverfahren und pharmazeutischen Komponenten lange umstritten und sind es in Teilbereichen auch weiterhin. Dies liegt nicht zuletzt in den unterschiedlichen Grundannahmen und der Tatsache begründet, dass sich Wirkungen der chinesischen Verfahren nicht anhand naturwissenschaftlicher Kriterien nachvollziehen lassen.
Auch Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft waren seit dem Beginn der Missionsarbeit in China 1847 mit den traditionellen Heilmethoden konfrontiert. Und wie die europäischen Ärzte und Mediziner, die sich zu dieser Zeit bereits im Land aufhielten, standen sie der chinesischen Medizin in der Regel distanziert, meist aber eindeutig ablehnend gegenüber.
Die Gründe für diese Haltung lagen nicht nur in einem bei manchen Missionaren ausgeprägten, allgemeinen Überlegenheitsgefühl gegenüber der chinesischen Kultur. Auf dem Feld der Medizin mussten die chinesischen Praktiker auch zunehmend als Konkurrenz wahrgenommen werden, umso mehr sich die Mission im sogenannten Missionsärztlichen Dienst und damit einhergehend im Aufbau von Krankenstationen, Apotheken und Hospitälern engagierte. Ein entscheidender Wettbewerbsvorteil um die Gunst der Patienten waren nicht nur die bei der Behandlung einiger Erkrankungen deutlichen Erfolge der Therapien, die sich auf das medizinische Wissen der Europäer stützten. Auch das Angebot einer kostenfreien Behandlung war für jene attraktiv, die sich chinesische Arzneien und therapeutische Anwendungen schlicht nicht leisten konnten. Denn eine Anwendung aus einer traditionellen Apotheke oder direkt auf einem Markt erstanden, war und ist je nach Qualität des Produkts mit nicht geringen Kosten verbunden.
In der Altstadt von Guangzhou, wo Missionare der RMG sich damals zeitweise einquartierten oder diese auf ihren Reisen besuchten, befindet sich auch heute der China-weit größte Markt für Produkte der TCM. Dort werden neben vielen Pflanzen- und Wildtierpräparaten auch Millionen von getrockneten Seepferdchen gehandelt.
Das Bild wurde von der Mission schon seit ihren Anfängen als Medium der Vermittlung genutzt. Bereits in den ersten publizierten Berichten der Rheinischen Mission 1830 ergänzen bildliche Darstellungen der Missionare die Berichte. Waren es zunächst Zeichnungen und bald auch die Fotografie, nutzte die Mission auch die Postkarte als Werbeträger. Ein sehr populäres Medium um die Jahrhundertwende.
Zwischen 1907 und 1917 ließ die Rheinische Mission „Ansichtspostkarten“ mit über 60 verschiedenen Motiven aus ihren Missionsgebieten drucken. Auflagenhöhe: zwischen 1000 und 5000 Stück je Motiv. Teilweise wurde nachgedruckt. Es gab verschiedene Motivgruppen. Obwohl die Produktion von farbigen Postkarten erheblich teurer war, wurden diese eher hergestellt, da sie sich besser vermarkten ließen.
Die frühen Postkarten aus Sumatra, zwischen 1912 und 1917 gedruckt, zählten etwa 30 verschiedene Motive. Auf den Postkarten wurden die Erfolge der Mission abgebildet. Die missionierten Batak, die Einrichtungen der Mission und Landschaften bildeten die Hauptmotive. Nach 50jähriger Missionsarbeit gab es viele Kirchen, Ausbildungsstätten, Schul –und Wohngebäude der Mission im Batakland auf Sumatra.
Die Landschaftsbilder zeigen die Ufer und die umgebende Landschaft des großen Tobasees auf Sumatra. Es handelt sich um reine Landschaftsbilder, die Kulturlandschaft und die Verbindung von Mensch und Natur.
Der Betrachter erhielt einen Einblick in die florierende Missionsarbeit, die um weitere Unterstützung bat. Die Bilder sollten für die Fortsetzung der Spendenbereitschaft sorgen und den Menschen in der Heimat zeigen, wo ihr Geld eingesetzt wurde.
Die Postkarte bot außerdem eine Möglichkeit, Informationen und Grüße auf unkompliziertem und weniger kostspieligem Weg, als dem Brief, zu vermitteln und wurde zahlreich genutzt.
Tansania
Ende 19./ Anfang 20. Jhd.
„Es ist merkwürdig, daß es kein Volk auf der Erde gibt, das keine berauschenden Getränke zu brauen verstünde und dieselben mit Freuden genösse.“
So beginnt ein Bericht in den Nachrichten aus der ostafrikanischen Mission aus dem Jahr 1910. Im Folgenden werden Herstellung und Konsum der regionalen Biervariante in der Usambara-Region im Nordosten Tansanias detailliert beschrieben. Die Filtration durch ein Gerät wie dem hier gezeigten, stellt dabei den vorletzten Schritt im Verarbeitungsprozess dar, an dessen Ende das alkoholhaltige Getränk steht:
„Auch unsere Schambala in Usambara bereiten sich ein trübes Bier (mpombe) aus dem süßen Saft des Zuckerrohrs. Die Männer pflanzen und ackern das Feld und gehen dann einige Tage vor dem Fest hin, um die schönsten Stauden herauszuschlagen und mit dem Buschmesser abzuschälen. So bringen sie die Bündel zu ihren Frauen, die das Zuckerrohr in große Holzmörser zerhacken und dann mit dem breiten Stößer so lange stampfen, bis jeder Saft herausgepreßt ist. Dann gießen sie Wasser darauf und holen mit den Händen die Fasern heraus. Diese werden mit einer langen Schnur umwunden, daß man sie kräftig auswringen kann. Zuletzt wird der verdünnte Zuckerrohrsaft durch einen geflochtenen Trichter filtriert und in einen großen irdenen Krug gegossen. Dort tut man Hefe hinzu, und in kurzem ist das Bier gegohren und kann in die großen, bauchigen Kürbisflaschen umgefüllt werden. So bringen sie die Frauen auf dem Kopfe zum Festgelage. Dort wird es von Männern und Frauen (doch getrennt) genossen, indem es aus kleinen langen Kürbisflaschen heraus mit einem Rohr gesogen wird.“
Alkoholkonsum war weder in den protestantischen Kreisen der Bethel Mission in Deutschland noch von deren nach Ostafrika entsandten Missionaren gern gesehen. Es wundert daher nicht, dass der Bericht in der Lektüre für die Unterstützer der Mission in den deutschen Heimatgemeinden auch eine moralische Wertung enthält sowie Möglichkeiten der Abhilfe thematisiert. So erfährt der Lesende weiter: „Diese Feste und Saufgelage halten die Heiden natürlich sehr in ihrem Bann und üben auch auf junge Christen zuweilen noch Anziehungskraft aus. Deshalb sannen die Missionare darüber nach, wie dem zu begegnen sei. Natürlich bleibt Belehrung, Ermahnung und Fürbitte immer das Hauptgegenmittel, doch es ist auch nicht ohne Wert, ihnen ein anderes erquickendes und doch harmloses Getränk zu verschaffen, die Brauselimonade.“
Zur Umsetzung des Vorhabens wurde die entsprechende technische Ausrüstung zur Karbonisierung von Fruchtsäften angeschafft. So ist in dem Artikel schließlich zu lesen, dass die „Sektfabriken“, wie sie genannt werden, den Vertrieb von Limonaden auf den Missionsstationen zwar ermöglichten. Aber letztlich mussten wohl auch die Missionare einsehen, dass ihrem Ersatzgetränk offenbar eine entscheidende Eigenschaft fehlte, wie es sich aus ihrem Fazit mit einiger Wahrscheinlichkeit ableiten ließe: „Christen und Heiden kamen zuerst in Massen, um diesen mpombe ya ulaia zu genießen. Jetzt ist das Verlangen danach zurückgegangen, doch würde das Eingehen der Fabriken schmerzlich empfunden werden. Namentlich die Handwerker, die sich etwas mehr fühlen und mehr Geld in Händen haben, wollen sich ab und zu einen guten Schluck leisten.“
Nicht zuletzt wird in diesem Fazit jedoch auch deutlich, dass die „industriell“ hergestellte Limonade zwar nicht in direkter Konkurrenz zu dem alkoholhaltigen Produkt aus der regionalen Brautradition bestehen konnte, wohl aber einen anderen, von der Mission durchaus erwünschten Effekt hatte. Jene, die sich aufgrund ihrer Anstellung auf den Missionsstationen - und somit auch durch ihre Einbindung in die von den Europäern im Rahmen der Kolonialisierung eingeführte Geldwirtschaft – das Produkt leisten konnten, mochten auch im Hinblick auf die Ziele der Mission als positive Rollenmodelle dienen.
Schwester Margarete Kissing war erstmals 1932 für 6 Jahre auf Nias tätig (Bild: gemeinsam mit Kolleginnen). Als ausgebildete Krankenpflegerin und Hebamme arbeitete sie im Krankenhaus in Hilisimaetanö, auf der Insel Nias, Indonesien. Es dauerte 16 Jahre, bis sie zum zweiten Mal ausreisen konnte. Aus dieser Zeit berichtet sie verschiedentlich im „Freundesbrief aus dem Schwesternheim“:
„Nun ist es wirklich wahr, daß ich nach gut 5 wöchentlicher Reise die kleine Insel Nias erreicht habe. Noch ist es mir ein Traum nach so langen Jahren … In der Nacht zum 19. Juni kamen wir in Gunung Sitoli an, konnten aber erst am nächsten Tage von Bord gehen, als die Zollstation geöffnet war … Wie es weitergeht, wann der Weg weiter nach dem Süden führt, daß weiß Er allein … Es ist Abend [27. August ] … Ich durfte in dieser Zeit manches sehen und hören und hinzu lernen und den Geschwisterkreis habe ich hier besonders dankbar genossen, sonderlich im Blick auf meinen einsamen Dienst im Süden … [Schwester Kissing war zunächst die einzige Europäerin im Süden Nias] … Am 23.10. verließ ich Gunung Sitoli, um die Reise nach dem Süden anzutreten … Mit mir fuhren Missionar Dörmann … und zwei niassische Mädchen, die mir im Haus helfen wollen. Um nach Teluk Dalam zu kommen, muß man heute erst einen Umweg machen. So ging´s erst nach dem Norden nach Singkel, dann nach Sibolga, um am 26.11. landeten wir in Teluk Dalam. Es war bald Mittag, als wir vier uns auf den 14 km weiten Weg nach Hilisimaetanö machten. Die ersten Kilometer ließen sich noch ganz gut wandern, aber dann wurde der Weg schlechter … Jedenfalls kamen wir ohne Unfall, wenn auch durch den immerwährenden Regen vollkommen durchnäßt, hier an … Nach 14 Tagen verließ uns Missr. Dörmann wieder, um nach Norden zurückzukehren. Ja, und nun möchte ich Sie am liebsten alle mal eben schnell in mein Haus führen; sehr groß ist es zwar nicht, aber doch groß genug und recht gemütlich und freundlich. Ich war froh, daß ich einige Zeit hatte, alles erst einzurichten. Freilich kam Dr. Thomson dann doch später, als er wollte, weil er keine Gelegenheit fand, nach hier zu kommen, und die Leute wurden allmählich ungeduldig. So lange hatten sie auf mich gewartet, und nun war ich da und half ihnen doch nicht! Aber konnte die Arbeit nicht beginnen, bevor sie mir nicht offiziell übergeben war. Doch dann kam der Doktor für 2 ½ Tage nach hier. … Der Zustand des Krankenhauses ist schrecklich, dieser Schmutz, diese Unordnung … und für die notwendigen Reparaturen fehlt noch das Geld, aber es ist schon von der Regierung zugesagt, man muß nur ein wenig Geduld haben … Es waren Wochen großer Unordnung und des Aufräumens. Und auch bis heute [Februar 1955] ist die Ordnung, sonderlich was die Medizinvorratsstube anbetrifft, noch lange nicht vollständig. Dort ist die meiste Arbeit. Jetzt sind wir bei der Medizinanfrage, der ersten, die ich mache; da keinerlei Unterlagen vorhanden sind, ist es dieses Mal eine ungeheure Arbeit. Und ich möchte sie doch gerne bald fort haben, weil ich fast keine Medizin mehr habe, die notwendigste fehlt, da die Vorräte nicht auf einen solchen Krankenbetrieb eingestellt sind … Meine beiden Hausmädchen Sa´adi und Julia machen mir viel Freude und umsorgen mich liebevoll, wenn ich müde aus dem Krankenhaus komme … Besonders schön für mich ist natürlich das Wiedersehn mit meinen früheren Mitarbeitern … Und wenn ich an manchen Tagen manchmal seufze … so spüre ich es immer wieder ganz deutlich, wie ich von betenden Händen getragen werde. So freue ich mich, daß ich noch einmal hier wirken und helfen darf.“
Schwester Margarete Kissing arbeitete bis zu ihrem Ruhestand 1965 im Süden Nias. Mit 93 Jahren verstarb sie 1998 in Deutschland.
Tansania
20. Jhd.
Der Ausdruck Musik aus der Konserve ist bei diesem Instrument wörtlich zu nehmen. Zwar wurde zur Herstellung des Korpus keine industriell gefertigte Blechdose verwendet, die ursprünglich der Konservierung eines Lebensmittels gedient hätte, aber das zentrale Bauteil besteht aus einem handelsüblichen 4-Liter- Eimer für Lackfarbe aus Walzblech.
Damit lässt sich das Instrument einer kleinen Gruppe von Objekten in der Sammlung der Archiv- und Museumsstiftung der VEM zuordnen, die ganz oder teilweise aus Recyclingmaterialien hergestellt wurden. Egal ob Kupferdraht, alte Autoreifen, Fahrradschläuche, Weißblechgetränkedosen, beschichtete Kartonagen für Fruchtsäfte oder Plastiktüten - es gibt viele Gebrauchtmaterialien aus industrieller Produktion, die bei der Herstellung von Spielzeug, Musikinstrumenten und Gegenständen des alltäglichen Gebrauchs zum Einsatz kommen können.
Und längst hat diese Art der Wiederverwertung von dem, was eigentlich einmal Abfall war, das Produktionsstadium für einen meist urbanen, auf ein weniger kaufkräftiges Publikum in den afrikanischen Metropolen aber auch in ländlichen Siedlungen ausgerichteten Markt verlassen. Craft-Center von Nairobi bis Kapstadt haben die Produkte aus recykliertem Material an die Bedürfnisse einer internationalen Kundschaft angepasst und bedienen ein touristisches Marktsegment mit teils sehr hochwertigen Objekten, die ein entsprechendes handwerkliches Geschick und Kreativität bei der Fertigung erfordern.
Nicht zuletzt wurde auch und gerade auf dem afrikanischen Kontinent die Arbeit mit Recyclingmaterialien schon vor Jahrzehnten von Künstlern und Künstlerinnen entdeckt. Ihre Arbeiten aus Hinterlassenschaften einer an der massenhaften Bereitstellung von Verbrauchsgütern und enormen Ressourcenverbrauch orientierten Industrieproduktion, die wiederum in mehrfacher Hinsicht auch Ergebnis eines importierten Wirtschafts- und damit verknüpften Gesellschaftskonzeptes sind, setzten und setzen sich oft kritisch mit eben diesem Phänomen auseinander.
Die gezeigte Trommel lässt sich aber nicht nur vor diesem Hintergrund betrachten. Denn mit ihren 18 Zentimetern Durchmesser und der fest verspannten Membran aus Ziegenhaut, ist das Instrument auch spielbar. Es ergibt sich zwar nicht der volle und tiefere Klang, den das Instrument mit einem entsprechenden hölzernen Korpus erzeugen würde, aber der höhere und ein wenig ‚blechern‘ gefärbte Klang hat durchaus seinen Reiz. In einem entsprechenden Ensemble oder als Begleitinstrument in einer performativen Inszenierung würde es zum Einsatz kommen können.
Und nicht zuletzt ist es auch die Zusammenführung von im klassischen Trommelbau verwendeten, organischen Material und dem (Abfall-)Produkt aus industrieller Massenfertigung, die den Reiz dieses Objekts ausmacht.
Jedes Jahr durchfahren etwa 19 000 Schiffe den Suezkanal. Der Kanal erspart den Schiffen und Frachtern einen Weg rund um das Kap der guten Hoffnung.
1869 eingeweiht, nutzten auch die Rheinische und die Bethel Mission diese Möglichkeit, ihre Missionare und Schwestern in kürzerer Reisezeit in die fernen Länder zu bringen. Ganz unterschiedlich beschreiben die Frauen und Männer ihre Eindrücke der oft monatelang währenden Reisen.
Kurz vor Fertigstellung des Kanals schreibt Friederike, Ehefrau des Missionars Ferdinand Genähr auf ihrer Reise nach China im Jahr 1868:
„Den andern Tag verließen wir Cairo, und auf der langsamen egyptischen Eisenbahn gings durch die Wüste bis Suez. Da sahen wir denn auch etwas von dem großen Suezkanal, der jetzt ausgegraben wird, und auf dem man künftig vom mittelländischen Meer direct ins rothe Meer fahren will. Er ist aber noch lange nicht fertig, und für’s erste wird man noch zu Lande nach Suez reisen müssen.“
Missionar Klammer, vom Heimaturlaub kommend, auf dem Weg zurück nach Sumatra, schreibt 1874:
„Das ist ein bewundernswerthes Bauwerk, dieser Suez=Canal. Durch den Sand der Wüste hindurch hat man so tief gegraben, daß die Ufer des Canals so hoch wie Eisenbahndämme zur Seite liegen, und immer tiefer noch wird der Canal ausgehöhlt und mit Steinen, die weither geführt werden, untermauert, denn der Sand fällt immer wieder nach und auch die Celebes drohte ein Paarmal auf den Grund zu fahren.“ […] Ins Land hinein kann man wegen der hohen Ufer nicht viel sehen. Hier und da stehen Strohhütten, einige Maisstengel in Gärtchen, dazwischen Schafe oder ein lasttragendes Kameel. Die Menschen sehen hier eben so grau aus, wie das Land, und man begreift kaum, wovon sie noch leben.“
Und Missionar Ludwig Ingwer Nommensen schreibt in seinem ersten Bericht 1882 über seine Reise: „Wir vier Missionare bewohnten eine Kajüte, die vier Schlafstellen hatte, aber ziemlich enge war. Wenn wir des Morgens und Abends unsere Andachten hielten, mußten wir vor Hitze Rock und Weste ausziehen, sobald wir in unser Logis hinunterkamen. - Am 23. abends kamen wir in Port=Said an und fuhren den 24. Nov. in den Suez=Canal ein, wo wir 2 Tage und eine Nacht zubrachten. Den 26. Nov., morgens 10 Uhr, fuhren wir von Suez ab ins rothe Meer ein und passierten die Stelle, wo die Israeliten durchgegangen sind beim Auszug aus Egypten und wo die Egypter ertranken. Links vom Suez ist der Mosesbrunnen, noch das einzige Grüne, welches das Auge erblickt. Man sieht rechts und links nur die kahlen Berge Arabien’s und Afrika’s. Ein trauriger Anblick!“
Agnes Kämpfer, Braut des Missionars August Landwehr beschrieb für die Rheinische Missions-Kinderzeitschrift „Der kleine Missionsfreund“ 1897 ihre Reise wie folgt:
„Auch das Schiff hatte sich schon wieder in Bewegung gesetzt und fuhr nun langsamen Laufes durch den Suezkanal. 10. März. Es gab zu viel zu sehen – trotz der öden Sandufer. Je und dann passierten wir eine Station, wo sich ein kleines Wärterhaus befand, dessen jugendliche Bewohner uns im Laufschritt eine ganze Strecke begleiteten und uns mit lauter Stimme aufforderten, ihnen etwas ins Wasser zu werfen. Auch sahen wir bei diesen Wärterhäuschen manchmal unbekannte Tiere, eine Art Ziegen ohne Hörner und mit ganz langen Ohren. Zuweilen erblickten wir auch einen schönen Palmbaum und etliche Male sahen wir einen Eisenbahnzug, der von Suez nach Port Said oder umgekehrt fuhr. Vor allem aber zogen kleine Karawanenzüge unsere Aufmerksamkeit auf sich. Einer lag dicht am Strande; ein großes Zelt war aufgeschlagen; die Kamele, von ihren Lasten befreit, hatten sich im Sande niedergestreckt Wir konnten alles in Muße besichtigen. Gegen 10 Uhr waren wir in Suez; dort hielten wir ein Weilchen, aber niemand verließ das Schiff."
Und auch im 20. Jahrhundert nahmen zahlreiche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Mission den Weg durch den Kanal, um in ihre Einsatzgebiete zu gelangen. Annemarie Töpperwien, Ehefrau des Missionars Karl-Christoph Töpperwien, beschreibt die Durchfahrt auf ihrem Weg nach Nias im 1958:
„Vor Port Said. Zum ersten Mal sehen wir arabische Schriftzeichen. Der ägyptische Lotse für die sehr versandete Hafeneinfahrt nähert sich. Das seichte Wasser ist gelb von den Schlamm- und Sandmassen des Nil, obwohl der große Mündungsarm Dutzende von km weiter westlich ist.
Port Said. Der ägyptische Lotse kommt an Bord, die Aktentasche hängt vor der Brust. Wir Weltreiseneulinge merken, dass wir nun endgültig eine fremde Welt betreten haben, und wir meinen, ihre politische Gespanntheit zu spüren … Jeden Morgen werden die Decks gescheuert, auch hier im Suezkanal. Sonntagmorgen, unser Geleitzug aus Port Said wartet im Großen Bittersee auf den Gegenzug aus Suez, denn der Kanal lässt nur Einbahnverkehr zu. Der Kanal benutzt diese ganz flachen Brackwasserseen. Als am Frühnachmittag endlich die Anker hochgingen und das Schiff zu wenden begann, ging es so langsam, dass wir befürchteten, wir säßen schon auf Grund. Im Nu wuchs um die „Oranje“ in dem grünlichen Wasser ein riesengroßer gelber Fleck – solche Sandmassen wirbeln die Schrauben auf dem flachen Grund auf. Ringsum hohe Dünenketten. … Ein ägyptischer „Spezialhändler“ hatte sich in Port Said an Bord gemogelt und das Schiff trotz aller Aufforderungen durch die Bordlautsprecher bei der Abfahrt nicht wieder verlassen. Sein Umsatz den Tag über auf dem Schiff, während der Fahrt und Warterei im Kanal, war ganz gut. In Suez kam ein kleines Boot am fahrenden Schiff längsseits und holte den Kollegen wieder ab. Das Geschäft ist also gut ausgebaut. … Fahrt durch die Bitterseen. Außerhalb der bezeichneten Fahrrinne säße ein großes Schiff sogleich hoffnungslos fest. So kommt das Fischerboot durch unsere Bugwelle gefährlich ins Schaukeln. Das Grün von Palmen und Siedlungen – von moderner Art im europäischen Stil – ist selten. Das Gelbbraun des Sandes regiert. … Der Kanal verlässt einen See. Links begleitet uns die Straße, auch die Eisenbahn. Welch eine Qual, bei der Hitze in einem der vorbeifahrenden Busse sitzen zu müssen! Aber morgens vor Sonnenaufgang mussten wir, schnatternd vor Kälte (das letzte Mal bisher), vor den Warmluftschacht aus dem Maschinenraum flüchten. So fuhren wir also im fahlen Morgenlicht auf einem Schiff durch die Wüste, zwischen zwei Erdteilen hindurch. Natürlich war kein Unterschied zwischen der „afrikanischen“ und der „asiatischen“ Seite.“
China
19./ Anfang 20. Jhd.
„Interessant war es, zu erfahren, wodurch die einzelnen zum Opiumrauchen gekommen waren. Achtzehn Personen behaupteten, sie hätten aus bloßer Neugierde oder zum Vergnügen zur Opiumpfeife gegriffen, während alle andern in Krankheitsfällen oder sonstwie in den Bann des Opiums geraten waren.“*
Diese nüchterne Bilanz zieht der englische Missionar White 1906 im Rahmen einer kleinen Erhebung zu den Ursachen der Opiumsucht in dem gut 1000 Einwohner zählenden Dorf Ayong in der chinesischen Provinz. Über gut ein halbes Jahrhundert hatte sich bis dahin der Opiumkonsum zwecks Erzeugung eines Rauschzustands oder zur Schmerzlinderung bei seinen regelmäßigen Nutzern etabliert und längst zum Massenphänomen nicht nur in den urbanen Zentren Chinas entwickelt. Dabei führten die Wege in die Abhängigkeit von dieser medizinisch grundsätzlich positiv wirksamen betäubenden und schmerzlindernden Substanz über ganz ähnliche Stationen wie es heute in vielen (post-)industrialisierten Gesellschaften mit chemisch verwandten oder ähnlich wirksamen Substanzen der Fall ist.
Für die christlichen und insbesondere protestantische Missionare, die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer zahlreicher aus Europa und Amerika nach China kamen, stellte die Opiumsucht neben dem verbreiteten Glücksspiel ein Laster und eine moralische Verfehlung besonderer Schwere dar, die es mit allen Mitteln zu bekämpfen galt. Nicht nur stand sie in absolutem Widerspruch zur protestantischen Ethik, sie führte in letzter Konsequenz auch medizinisch gesehen zu schweren Suchterkrankungen bei unmittelbar betroffenen Männern und Frauen. Aber auch das familiäre Umfeld war in Form der gravierenden Auswirkungen betroffen, mit denen Angehörige von Suchtkranken oft konfrontiert sind. Betroffene konnten nur im Zuge der Genesung oder als bereits Genesene im Sinne der Mission erfolgreich zum Christentum bekehrt werden, bzw. nur als Letztere Teil einer christlichen Gemeinde werden.
Auch aus diesem Grund waren White und ein Missionsarzt der englischen Church Mission Society auf Einladung der Ortsvorsteher nach Ayong gekommen, um den laut Bericht 80 Suchtkranken des Dorfes eine Therapie zu ermöglichen. Der medizinische Erfolg ging hier, wie es nicht selten der Fall war, auch mit einer großen Zahl an Konvertierten einher.
Christliche Missionare befanden sich allerdings noch in einem Dilemma ganz anderer Art. Denn es waren die Regierungen der Länder, aus denen sie entsandt worden waren, allen voran Großbritannien, die gegen den erbitterten Widerstand der chinesischen kaiserlichen Verwaltung und mit militärischer Gewalt den chinesischen Markt für Opium öffneten. Produziert und geliefert wurde es von den britischen Kolonien in Süd- und Südostasien. Die nach den sogenannten Opiumkriegen ungehinderte Einfuhr führte nicht nur zu gesteigertem Opiumkonsum und einer ansteigenden Zahl der Suchtkranken mit schwerwiegenden Folgen für die chinesische Gesellschaft. Vielmehr ermöglichte sie dem britischen Fiskus auch erhebliche Steuereinnahmen durch sein Handelsmonopol für die Substanz.
Die Reaktion der Missionsgesellschaften war deutlich. So heißt es beispielsweise in einem Traktat mit dem Titel „Der Fluch des Opiums.“, der 1906 im Verlag der Basler Missionsbuchhandlung erschien: „Ist es aber nicht befremdlich, daß dieselben Engländer, die den Ruhm beanspruchen, den Sclavenhandel in Afrika zuerst bekämpft und aufgehoben zu haben, durch ihren Opiumhandel so viele Tausende in China, Barma und Indien ruinieren? Ein Staatseinkommen von einem Laster bezogen, verrät nicht Staatsweisheit, wohl aber Gewissenlosigkeit.“
Zwar verurteilten alle Missionsgesellschaften diesen Aspekt der Kolonialpolitik, andererseits bedienten sie sich aber gerne des eindringlichen Bildes des „bekehrten Opiumrauchers“, um ihre Missionserfolge zu dokumentieren und in Europa für die Unterstützung des Kampfes gegen die Sucht als Wegbereiter des Christentums in China zu werben. Der rheinische Missionar Ferdinand Genähr erzählt für eine in Barmen 1898 veröffentlichte Werbebroschüre für die China-Mission eine ebensolche Geschichte nach, in der zu lesen ist: „Sein Entschluß stand fest: ‚Fortan werde ich kein Opium mehr rauchen! Aber zum Dank für meine Erlösung will ich nach Hok Tschiang gehen, um den Leuten zu sagen, daß Jesus sie von ihren Sünden erretten kann.‘ “**
*Ein Kreuzzug gegen das Opium. Missionsmagazin 1907 nach dem Chinese Recorder; hier in Frühlingswehen in der Völkerwelt, Calw/Stuttgart 1908
**Ein bekehrter Opiumraucher, Barmen 1898
1907: Der Bethel-Missionar Johanssen und Diakon von der Heyden machten sich von Dsinga, der ersten Missionsstation der Bethel Mission in Ruanda, auf den Weg zu dem Platz, an dem die zweite Station errichtet werden sollte.
König Msinga, der zunächst seine Erlaubnis zu dem angedachten Ort gegeben hatte, zog diese zurück, so, dass die Mission einen anderen Platz finden musste.
Missionar Johanssen schreibt dazu: „Die Abgesandten erklärten … wenn wir trotzdem bleiben wollten, so sei es nur möglich gegen Msingas Willen, wenn wir glaubten, es auf eigene Macht tun zu können. Es war ausgeschlossen, dass wir gegen Msingas Willen uns zum Bleiben entschließen konnten.“
Am 21. August 1907 schreibt er weiter: „Ich habe mich entschlossen, über Bussaro zu Msinga selber zu gehen, um für die Zukunft uns nach Möglichkeit derartige Vorkommnisse zu ersparen. Es kann für die ganze Arbeit von Wichtigkeit sein, dass der König einen Eindruck davon bekommt, wie betrübt wir über die ganze Behandlung sind.“
Drei Tage später erreichten sie die Residenz König Msingas. Nach intensiven, positiven Gesprächen stellte König Msinga Begleiter für die Zeit zur Verfügung, bis ein neuer Platz gefunden sei. Nach einem 2-Tages-Marsch errichteten sie ihre Zelte auf einer Anhöhe in einem Tal.
Johanssen schreibt: „Es fing wieder an zu regnen; es war schwer, bei diesem Wetter, in dieser Umgebung, unter diesen Umständen so recht fröhlich zu sein. Gegen halb sechs (am 27. August) hatte der Regen aufgehört, ich ging noch etwas fort, wie immer in diesen Tagen mit der Bitte im Herzen: Herr, zeige uns den Platz, den Du uns bestimmt hast. So kam ich zu einem Hügel (Kirinda genannt), auf dem sich schon am Morgen meine Aufmerksamkeit gerichtet hatte, als ich ihn von ferne sah. Die Wasserverhältnisse waren überaus günstig, ein starker Bach durchfloß den anstoßenden Grund, von oben kommend … Ich stieg auf die Anhöhe und war überrascht von dem lieblichen und großartigen Landschaftsbild … Jenseits … stiegen grüne Weideflächen sanft in die Höhe, von hohen Bergen überragt … Im Osten und Südwesten sah man ebenfalls hinaus auf schön geformte Berge, übersät mit Ansiedlungen. Im Nordosten, Norden und Nordwesten und Westen traten die Berge näher an den Höhenzug, auf dem ich stand, heran, talaufwärts zogen die Kuhherden heim, und im Westen stand die breite Anhöhe mit einem noch höheren Berg durch einen Sattel in Verbindung.
Man könnte sich für eine Missionsstation kaum einen schöneren Platz im Gebirge vorstellen, weil er weithin sichtbar ist, etwas Abgeschlossenes bildet und doch mitten zwischen Ansiedlungen liegt, die ganz leicht zu erreichen sind … Da wurde es mir innerlich gewiß, der Herr selber hat uns diesen Platz zugedacht.
Wie waren unsere Herzen erfüllt von Freuden und Dank in der Gewißheit, daß unser Reisen jetzt ein Ende habe, nachdem ich fast vier Monate von Ort zu Ort gezogen war.“
Die Wahl des Ortes fand Zustimmung durch König Msinga. Er und seine Männer unterstützten die Missionare bei der Errichtung einer ersten Hütte und der Zelte.
Nach und nach etablierte sich Kirinda als zweite Missionsstation der Bethel Mission in Ruanda.
Die presbyterianische Kirche in Ruanda, EPR, unterhält heute unter anderem ein Krankenhaus in Kirinda, das zuletzt im Rahmen der Coronahilfen Unterstützung durch die VEM erfahren hat.
Das Bild zeigt die Station im Jahr 1914.
Tansania
um 1908
Werkstück oder schon kleines Kunstwerk? Hergestellt wurde diese ca. 10 cm hohe Vase in einer Werkstatt der Evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch Ostafrika (später in Bethel Mission umbenannt). Die Gesellschaft unterhielt in der ehemaligen Kolonie, dem heutigen Tansania, am Beginn des 20. Jahrhunderts einige Werkstätten, von Schreinereien über Töpfereien und Nähereien bis hin zu einer Druckerei. Sie waren den Missionsstationen angeschlossen. Die kleinen Betriebe sollten nicht nur einen Beitrag für eine angestrebte wirtschaftliche Unabhängigkeit der Stationen leisten. Vielmehr waren sie auch als Ausbildungsstätten für die Menschen gedacht, die sich im Laufe der Zeit um die Stationen herum ansiedelten.
Stücke wie das gezeigte wurden von afrikanischen Gesellen hergestellt. Dies geschah unter Anleitung von eigens zu diesem Zweck durch die Missionsgesellschaft angeworbenen deutschen Handwerksmeistern. Der Einfluss der Ausbilder spiegelt sich dabei deutlich in technischer und formal-ästhetischer Hinsicht in dem Werkstück wieder. Es wurde unter Nutzung einer rotierenden Töpferscheibe bearbeitet und entspricht in seiner Form dem europäischen Geschmack der Zeit. In einem tansanischen Haushalt um die vorletzte Jahrhundertwende gab es für einen solchen Gegenstand zunächst einmal keine sinnvolle Verwendung. Hergestellt wurden diese Töpferwaren - wie andere Dinge des täglichen Gebrauchs - daher für den Export nach Deutschland. Sie wurden dort auf Missionsfesten, Weihnachtsbasaren und zu ähnlichen Anlässen verkauft. Mit seinem umlaufenden Dekor aus gleichseitigen Dreiecken gelangte mit dem gezeigten Stück allerdings auch ein gestalterisches Element nach Deutschland, das dem ästhetischen Empfinden jener Menschen entsprach, die die Dinge schufen.
Auch für das bergische Land ist ein Verkauf vergleichbarer Dinge durch eine andere Missionsgesellschaft, die Rheinische Mission, belegt. In ihrem Missionshaus in Barmen verkaufte man in den 1850er Jahren „Cigarrenpfeifen mit schön polierten Köpfen“, die auf der Station Steinkopf im heutigen Südafrika gefertigt wurden. Der interessierte Barmer Bürger konnte ein solches Stück zum Preis von fünfzehn Groschen erwerben. Aber auch „Auswärtige“ konnten „ihre Bestellungen an das Missionshaus unter der bekannten Rubrik unserer Gesellschaft machen“, wie es in einem Bericht aus dem Jahr 1854 zu lesen ist.
Am 25. März 1981 wurde, in Anwesenheit der Missionsleitung, vieler Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie Freunden der VEM der Grundstein zum Neubau des Missionshauses gelegt.
Das erste Missionshaus der Rheinischen Mission war 1832 eingeweiht worden, wurde 1862 erweitert und damit um das Doppelte vergrößert.
1917 wurde ein weiteres Gebäude auf der Hardt, dem „Heiligen Berg“, errichtet, das später zum Missionsseminar und 1971 als Ökumenische Werkstatt seine Verwendung fand. Der ursprüngliche Plan, hier auch einen Erweiterungsbau für die gesamte Arbeit der VEM zu errichten, konnte aus finanziellen Gründen nicht realisiert werden.
Da eine dringend nötige Renovierung des Missionshauses in der Rudolfstraße anstand, entschied sich die Missionsleitung 1978 zu einem Neubau.
Bereits im August 1978 traf eine Arbeitsgruppe, das so genannte Preisgericht, zusammen, und debattierte über die fünf eingegangenen Bewerbungen verschiedener Architekturbüros. Das Anforderungsprofil umfasste Punkte wie städtebauliche und baurechtliche Belange wie z.B. Erschließung und Baurecht, Programmerfüllung (Raumprogramm), Funktionserfüllung, die Gestaltung und schließlich die Wirtschaftlichkeit.
Vor- und Nachteile der Entwürfe wurden detailliert besprochen. Keine Bewerbung bekam direkt den Zuschlag. Es erfolgten Korrekturen und Anpassungen, bis schließlich der Grundstein gelegt wurde.
Während das alte Missionshaus abgerissen wurde, begannen bereits die Arbeiten am Neubau. Zur Gestalt des Neubaus schrieb die Mission in einem Erläuterungsbericht: „Dabei ist zu beachten, dass das alte Haus ein „Gesicht“ hat und das neue nicht anonym wirken darf. Auch das neue Bild muß einprägsam, darf aber nicht aufdringlich sein.“
Am 21. Oktober 1982 wurde das neue Missionshaus festlich eingeweiht. Noch heute ist es das Zentrum der VEM in Deutschland. Inzwischen wurde es den neuen Anforderungen an Brandschutz und Klimawerten angepasst und ist fester Bestandteil der „Ecke“ Rudolfstraße/Schönebecker Straße.
Deutschland, 1890er Jahre
„Auf vielfache Anregung hin beabsichtigen die unterzeichneten Freundinnen und Freunde der Jungfrauenvereinssache (im Anschluß an eine Besprechung, die in Verbindung mit einer Vorstände-Konferenz am 3. Februar ds. Js. in Barmen stattgefunden hat) einen Zusammenschluß der Jungfrauenvereine innerhalb der Rheinprovinz durch Bildung eines Provinzialverbandes herbeizuführen.“
Mit diesen Zeilen beginnt ein Aufruf „An die Jungfrauenvereine des Rheinlandes!“ im April des Jahres 1908. Aus gutem Grund stammt die Mehrzahl der Unterzeichnenden aus dem Tal der Wupper und hat ein Amt in einer der dort ansässigen evangelischen Gemeinden inne. Neben Pastorin Coerper und Pastor Burghart aus Barmen sowie Pastor Niemöller aus Elberfeld sind aber auch Laien wie Frieda Ufer aus Barmen und Julius Schniewind aus Elberfeld vertreten. Denn in der damaligen preußischen Rheinprovinz galten die Gemeinden im Tal der Wupper nicht nur als besonders fromm, sondern waren auch für ihr intensives gesellschaftliches Engagement in zahlreichen Bereichen wie z.B. der Jugendarbeit- und Organisation von Frauen in Vereinen bekannt.
Der Aufruf war erfolgreich und führte zur Gründung eines Provinzialverbandes noch im gleichen Jahr. Sein frisch berufener Vorstand konnte mitteilen: „Die erste Umfrage des neugegründeten rheinischen Provinzialverbandes der Jungfrauenvereine hat ein erfreuliches Resultat ergeben. Zahlreiche Vereine haben sich angeschlossen und viele derselben haben auch feste Jahresbeiträge gezeichnet oder angekündigt.“
Der hier zu sehende Teller datiert gut zehn Jahre früher und steht in der Dauerausstellung des Museums auf der Hardt für die vielen Jungfrauen-Missions-Gesangvereine sowie die vielfältigen Unterstützerorganisationen der Rheinischen Missionsgesellschaft in der Rheinprovinz. Denn die in Barmen zum Zeitpunkt der Gründung des Provinzialverbandes 1908 bereits seit 80 Jahren existierende Missionsgesellschaft profitierte wiederum sehr von diesen kleinen Organisationen und Vereinen, die bei ihren Veranstaltungen regelmäßig für die Sache der Verbreitung des Christentums ideelle, vor allem aber auch materielle Unterstützung einwarben.
Vor diesem Hintergrund wundert es nicht, dass in der Vorstandsadresse des Provinzialverbandes „An die evangelischen Jungfrauenvereine der Rheinprovinz“ der Hinweis zu lesen ist: „Besonders bemerken wir noch, dass für solche Vereine, welche besonderes Interesse daran haben für Heidenmission interessiert zu werden, eine Missionsschwester der rheinischen Mission, welche in China gearbeitet hat, zur Verfügung steht.“
Der Name der Missionsschwester wird in dem Papier nicht genannt, doch handelt es sich um die in Mönchengladbach geborene Helene Schmitz. Sie hatte sich bereits in Berlin im „Verein zur Fürsorge für die weibliche Jugend“ engagiert bevor sie mit 38 Jahren für die Rheinische Missionsgesellschaft nach Taipeng ausreiste, um auch dort in der Bildungsarbeit, nun jedoch unter chinesischen Frauen tätig zu sein. Ihren Einsatz dort musste sie aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beenden und kehrte 1907 nach Deutschland zurück. Da sie sich daraufhin in Barmen der Schwesternarbeit widmete, lag auch eine Tätigkeit für die ansässigen Jungfrauenvereine nahe. Indem sie dort über ihre Erfahrungen in Asien berichtete, betrieb sie nicht zuletzt Werbung in den Kreisen der jungen, missionsinteressierten Frauen für ein Engagement für die oder auch in der Missionsgesellschaft.
Gesungen wurde seit den Anfängen der Mission. Im Laufe der Jahre lernten die Missionare und Schwestern die heimischen Sprachen, Gesangbücher entstanden.
In Namibia, damals Südwestafrika, bemühte sich die Mission, möglichst einheitliche Gesangbücher in der Herero- und der Namasprache zu erstellen. Wie gewissenhaft das geschah, davon zeugt ein Dokument des Missionars Heinrich Vedder um 1930. Er zeigt darin den Aufbau, die Unterschiede und die Besonderheiten auf.
„Das Gesangbuch der Hererogemeinden … umfasst 240 Gesänge. … Das Namagesangbuch enthält 259 Lieder.“
Eine Übersetzung der beiden Gesangbücher in Deutsch gab es nicht, sie war nicht vorgesehen und wurde als nicht notwendig erachtet.
„Über die Herkunft der Gesänge ist zu sagen: Im Hererogesangbuch entstammen
Im Namagesangbuch entstammen
Die Gesangbücher wurden in Liedergruppen unterteilt. Diese titelten z.B. Lob- und Danklieder, die kirchlichen Zeiten, Kirche und Gnadenmittel, Tod, Gericht und Ewigkeit, das heilige Abendmahl, das christliche Leben.
„Die Uebersetzungen aus deutschen Gesangbüchern sind weit davon entfernt, etwa möglichst wörtlich zu sein. Soweit es möglich war, ist der Grundgedanke des Gesanges festgehalten worden.“
Da in einigen Regionen des Landes sowohl Nama als auch Herero Mitglieder der jeweiligen Gemeinde waren und oft gemeinsame Gottesdienste gehalten werden mussten, baute man die Gesangbücher möglichst übereinstimmend auf.
Dichtungen der lokalen Bevölkerung waren zunächst nicht Teil der Gesangbücher, obgleich beispielsweise der Lehrer und Evangelist Petrus Jod zahlreiche Lieder übersetzte.
Der Gesang spielte eine große Rolle während der Gottesdienste, Lieblingslieder kristallisierten sich in den Gemeinden heraus. Insbesondere die Frauen der Gemeinden sangen viel und gern, auch außerhalb der Gottesdienste. „Es gibt manche Frauen, die das ganze Gesangbuch auswendig wissen, und abends stundenlang vor ihren Hütten am Abendfeuer mit den Nachbarinnen singen.“ Begleitet wurde die Gemeinde durch eigene Posaunenchöre oder Streicher.
Missionar Vedder konstatiert am Ende seines Berichtes: „Wenn es irgendwo wahr ist, dass das Evangelium in die Herzen gesungen werden kann, dann ist das in Südwestafrika wahr.“
Bild: Streicherchor, Okombahe, Namibia
Borneo, Indonesien
Ende 19. oder 20. Jhd.
Worfelschalen können in Größe, Form und dem zu ihrer Herstellung benutzten Material variieren. Sie dienten oder dienen bis heute aber in allen Teilen der Welt, in denen Ackerbau mit Feldfrüchten betrieben wird, deren Verwertung eine Entspelzung der Fruchtkörper voraussetzt, als einfaches, aber effizientes Arbeitsgerät.
Bei diesem Prozess, wird das abgeerntete Getreide – je nach Region, Klima und Bodenbeschaffenheit kann oder konnte es sich um Einkorn, Emmer, Weizen, Roggen, Hirse, Reis, etc. handeln –zunächst gedroschen, um die Hülle der Körner aufzubrechen. Anschließend werden die Körner möglichst gegen die Windrichtung in die Luft geworfen, um im sprichwörtlichen Sinn „die Spreu vom Weizen zu trennen.“ Dabei lassen sich die Gesetze der Schwerkraft in Relation zur unterschiedlichen Dichte und dem entsprechend unterschiedlichen Gewicht der beiden Komponenten Fruchthülle und Stärkekörper nutzen. Während die eine von der Luftströmung verblasen wird, fällt die andere unmittelbar zu Boden. Eine möglichst großflächige, flache, stabile, aber dabei dennoch leichte Schale vereinfacht den Vorgang dieser Trennung, des sogenannten Worfelns, erheblich. Im Vergleich zu einem simplen Hochwerfen des Getreides mit beiden Händen, ist die Nutzung einer Worfelschale nicht nur effizienter, was die Menge des bei einem Vorgang behandelten Erntegutes angeht. In der Summe ist auch wesentlich weniger Kraftaufwand notwendig. Je ausladender die Schale ist, umso leichter lässt sich schließlich auch ein unkontrolliertes zur Erde Fallen der Körner verhindern, die stattdessen in die Schale zurückfallen.
Die knapp 70cm lange und etwa 50cm breite Flechtschale aus Indonesien erfüllt die Voraussetzungen für das Worfeln von Reis in geradezu idealer Art und Weise. An den beiden auf die Spitze zulaufenden Seiten des umlaufend eingeflochtenen Reifs, lässt sich die Schale mit ausgestreckten Armen gut anfassen. Dabei weist das spitz zulaufende Ende auf den Körper. Die dann mit Schwung ausgeführten Auf- und Ab-Bewegungen lassen die Körner in die Höhe schnellen. Nach dem Auffangen lassen sie sich dann portionsweise in geeignete Behälter abfüllen.
In ländlichen Gebieten Süd-, Südostasiens und Afrikas werden Worfelschalen von Kleinbauern nach der Ernte für den eigenen Bedarf häufig noch eingesetzt. Hierzulande kann man lediglich noch in Freilichtmuseen mit etwas Glück eine Inszenierung der Nacherntebehandlung von Getreide mit Dreschflegel und Worfelschale durch entsprechend geschultes Museumspersonal oder ehrenamtliche Laiendarsteller und –darstellerinnen erleben.
Das im südlichen Namibia gelegene Bethanien wurde 1814 von Missionar Johann Heinrich Schmelen gegründet, der damals noch im Dienste der Londoner Missionsgesellschaft stand. Schmelen errichtete eines der wohl ersten von Europäern gefertigten Steinhäuser Südwestafrikas. Es steht noch heute und wird als Museum, das an die Geschichte des Ortes erinnert, genutzt. Er war es maßgeblich, der die Rheinische Mission 1839 zur Mitarbeit nach Südwestafrika einlud.
1842 ging die Missionsstation Bethanien dann an die Rheinische Mission über. Missionar Hans Christian Knudsen war der erste von der RMG stationierte Missionar vor Ort. Die ersten Taufen fanden bereits im Dezember 1842 statt und Gehilfen wurden von ihm ausgebildet, die ihn in seiner Arbeit in den weit verstreuten Ortschaften unterstützten.
Im Bericht der Rheinischen Mission von 1844 heißt es dazu: „Die bekehrten Namas haben einen großen Eifer, das Heil, welches sie selber durch das Evangelium empfangen, auch Andern … anzupreisen, die noch nichts davon gehört haben, und es wird dem Br. Knudsen auf seinen Reisen sehr oft die Freude zu Theil, gesegnete Wirkungen davon zu gewahren.“
1851 verließ Missionar Knudsen die Station Bethanien.
Am 26. Juni 1859 wurde die Kirche in Bethanien eingeweiht.
1883 spielte sich in Bethanien der Landverkauf rund um Angra Pequena, der heutigen Lüderitzbucht, von Nama-Oberhaupt Josef Frederiks II., durch den die Gründung der deutschen Kolonie ermöglichen werden sollte bzw. der Landerwerb eines im Auftrag von Adolf Lüderitz stehenden Kaufmanns und damit der sog. “Meilenschwindel“ (deutsche Meilen vs. englische Meilen) ab.
China
Zweite Hälfte 20. Jhd.
Die 22 cm große Skulptur aus Kampferholz verweist sowohl konkret auf die sozusagen materielle Ausgangssituation als auch auf den übertragenen Sinngehalt eines in allen vier Evangelien der Bibel beschriebenen, durch Jesus Christus am See Genezareth vollbrachtes Wunder. In der auch als ‚Wundersame Brotvermehrung‘ bekannten Episode stehen Jesus und seinen Jüngern für die Speisung von 5000 Menschen zunächst nur ‚Fünf Brote und zwei Fische‘ zur Verfügung. Diese vermehren sich im Verlauf der Geschichte, bzw. während der Verteilung der Nahrungsmittel jedoch unmerklich, sodass alle an dem Mahl Teilnehmenden satt werden. Die im Nachhinein durch die Jünger eingesammelten Reste hätten wiederum zwölf Körbe gefüllt, so die Überlieferung weiter.
In ihrer künstlerischen Ausführung verweist die Skulptur aber auch auf den kulturellen Kontext, aus dem sie stammt. Insbesondere die Ausarbeitung der beiden die Brote ringförmig umschließenden Fische erinnert stark an die Darstellung der Tiere in der traditionellen chinesischen Malerei und Plastik. Sie ist damit auch vor dem Hintergrund einer in China nach wie vor gültigen Form der indirekten Kommunikation in den gesellschaftlichen Beziehungen zu sehen. Der Fisch, yú (鱼), steht hier neben anderen Bedeutungen für Reichtum bzw. Überfluss. Ein Umstand, der auf eigentümliche Weise die ursprünglich nahöstlich, bzw. europäisch geprägte Symbolik aufgreift, wie sie sich in der Bibel findet.
Wahrscheinlich lässt sich die Skulptur dem Künstler Zhang Wanlong oder seinem Umfeld zuordnen.
Sie kam während eines Besuchs von Vertretern der Chinese Rhenish Church of Hongkong, eines Mitglieds der Vereinten Evangelischen Mission, als Gastgeschenk nach Wuppertal und in den Bestand der Archiv- und Museumsstiftung der VEM. Die Geschichte dieses Zweigs der VEM reicht bis in das Jahr 1847 zurück, als der erste Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft in die damalige britische Kronkolonie reiste.
Die Skulptur ist in der Dauerausstellung im Museum auf der Hardt zu sehen und verweist neben entsprechenden Originaldokumenten und Reproduktionen historischer Fotos auf die Entwicklung von Missionsgemeinden unter der Leitung deutscher Missionare von der Mitte des 19ten Jahrhunderts hin zu den unabhängigen Kirchen der VEM in Afrika und Asien heute.
Hermann Linden, ausgebildeter Schlosser, erfuhr eine christliche Erziehung durch seine Großeltern. Durch seinen Kontakt zum Jünglingsverein kam er zur Mission. Er war, nach seinem Besuch des Seminars der Rheinischen Mission in Barmen, von 1903 bis 1933 in Tungkun tätig. 1905, auf einer Bootsreise mit Missionar Diehl, wurde er überfallen und erlitt eine Schussverletzung. Die Folgen haben ihn durch sein ganzes Leben begleitet. Auch in Tungkun war er mit Kämpfen der Kommunisten und der Reaktion der Regierung konfrontiert. Er blieb dort und unterrichtete am Lehrerseminar und später auch an der Bibelschule. Bei den Schülerinnen und Schülern war er sehr beliebt.
Über das Weihnachtsfest 1927 schreibt er:
„In der Kapelle stand der geschmückte Weihnachtsbaum in hellem Glanz, um Zeugnis abzulegen von dem wahrhaftigen Licht, das in diese dunkle Welt gekommen ist, um alle Menschen zu erleuchten. Und um den brennenden Lichterbaum sammelte sich die Jugend und die Alten, und ein froher Glanz lag auf allen Gesichtern und der Glanz der Kerzen spiegelte sich in blanken Augen. Der Mitfeiernden von draußen waren weniger als in früheren Jahren, da die Räuberbanden ihr Wesen schlimmer trieben in den letzten Wochen, so wagten viele am Abend sich nicht hinaus in die Kapelle.
Einer guten Ansprache über die Weihnachtsgeschichte folgten im Wechsel Aufsagen der alten und doch immer wieder neuen Weissagungen wie der mehrstimmige Gesang der allbekannten Weihnachtslieder. Mit besonderer Freude aber und mit größter Aufmerksamkeit wurde eine von einem jungen Lehrer erzählte Weihnachtsgeschichte aufgenommen.“
Linden schreibt zum Ende seines Berichtes: „Mit Gesang, Gebet und Segen schloß dann unsere Christfeier, und dankbar über die Offenbarung der Liebe Gottes gingen wir heim … Nach Schluß der kirchlichen Feier wurden die Schüler mit einer kleinen Weihnachtsgabe erfreut, die zum Teil von lieben Freunden in der Heimat ihren Weg zu uns gefunden hatten. … Das war unsere Weihnachtsfeier in Tungkun im Jahr 1927.“
Das Bild zeigt die Stationskinder beim Weihnachtsreigen drei Jahre später, 1930.
Ruanda oder Tansania
Ende 19. oder. 20. Jhd.
Die Kochbanane (musa paradisiaca L.) ist insbesondere in der Region der großen ostafrikanischen Seen ein weit verbreitetes Grundnahrungsmittel. Sie wird in ländlichen Gebieten oft auf kleineren Parzellen für den Eigenbedarf oder den Verkauf auf lokalen Märkten angebaut. Die immergrüne, krautige Pflanze wird häufig in direkter Umgebung der Häuser angepflanzt, was ihre Pflege und Bewirtschaftung erleichtert.
Für die Ernte der in mehreren Kilo schweren Büscheln wachsenden Früchte hat sich ein Gerät wie das hier gezeigte bewährt. Das halbmondförmig geschmiedete Messerblatt erinnert an eine Sichel, ist aber im Durchmesser wesentlich kleiner und an den Umfang der Basis eines Büschels angepasst. Dieser Typ eines Erntemessers lässt sich durchaus als Spezialgerät bezeichnen. Im Gegensatz zu dem ebenfalls oft bei der Feldarbeit verwendeten Haumesser, ermöglicht das Erntemesser ein wesentlich behutsameres Abtrennen des Büschels von der Pflanze, was bei der vergleichsweise hohen Empfindlichkeit der Früchte von Vorteil ist.
Die Früchte zeichnen sich durch einen hohen Stärkegehalt aus und werden vor allem zur Herstellung von Matoke genutzt. Die relativ harten Fruchtkörper werden dazu traditionell in Bananenblätter gewickelt und für mehrere Stunden gedünstet. Nach der Garung werden sie zu einem Brei zerstampft und mit passender Soße oder als Beilage zu gekochtem oder gegrilltem Fleisch gegessen. Darüber hinaus ist die Herstellung von Bananenbier durch die Vergärung der Fruchtkörper in der Region weit verbreitet.
Nicht zuletzt mag der durch langen und intensiven Gebrauch glatte, nahezu glänzende lederne Bezug des hölzernen Griffs von einem besonderen Verhältnis des Besitzers zu dem hier zu sehenden Gerät zeugen. In der Regel wurden die Geräte ohne eine solche Ummantelung hergestellt und genutzt.
Einblicke in das Stationsleben aus dem Jahr 1913, Quartalsbericht von Missionar Eduard Müller an die Heimatleitung in Barmen:
„Gemeindeangelegenheiten.
Siantar: Auch im letzten Halbjahr hat die Gemeinde wieder stark durch Zuzug zugenommen. … Da Siantar Stadtgemeinde geworden ist, so werden jetzt an die im Bezirk Ansässigen Grundbriefe ausgegeben. Dies hat die natürliche Folge, dass der Grund und Boden, den die Leute für nichts erhalten haben einen Wert von tausenden erhält. Als einzige Leistung müssen dann fortan die Leute eine gewisse Grundsteuer bezahlen. … Auch unser Missionsgrundstück hat durch die Grundbriefe einen grossen Wert erhalten. In bester Lage, in einer Hauptstrasse, bei einer Strassenfront von 250 Meter, hat es ca. 35 000qm Flächenraum. …
Der Kirchbau konnte inzwischen bis auf einige Kleinigkeiten, vollendet werden, ebenso wurde sie auch mit Oelfarbe gestrichen. Zwei Glocken, von einer Sonntagsschule in meiner Heimat und einer S. Schule in Bochum gestiftet, kamen auch zur grossen Freude der Gemeinde an. …
Der Gottesdienstbesuch ist durchweg gut, ja oft sehr gut zu nennen.
Neu eingerichtet sind monatliche einmalige Zusammenkünfte von Aeltesten, Radjas und Männern, wo über allgemeine Gemeindeangelegenheiten beraten wird und besonders um gute Sitten und Gebräuche in Gemeinde und Haus einzubürgern z.B. Hochzeiten, Trauerfälle u.a. Der leitende Gedanke bei diesen Zusammenkünften ist, um mehr Freudigkeit am Gemeindeleben … zu wecken. …
Das Schulgebäude hier wurde in den letzten Monaten völlig umgebaut. Es hat nunmehr 2 Klassenräume und ist mit Wellblech gedeckt. …
Die Arbeit hier in Siantar häuft sich je länger je mehr, ich stehe nicht an zu sagen, dass ich der Arbeit auf den soweit zerstreuten Filialen nicht nachgehen kann als ich müsste. Befriedigend ist ein solcher Zustand auf die Dauer nicht.“
Heute befindet sich die Kirche auf dem Bild in Besitz der HKBP, einem Mitglied der VEM.
Seit 2019 befindet sich das Regionalbüro Asien der VEM in Pematangsiantar. Es hat seinen Sitz nach vielen Jahren in Medan, nun in einer Region, von der aus die Rheinische Mission ihre Arbeit auf Sumatra begann.
Sumatra (ggf. Import nach Borneo)
19. /Anf. 20. Jhd.
Betelscheren aus Gelbguss oder geschmiedet gehören zur Grundausstattung für die Herstellung eines beliebten Genuss- und leichten Rauschmittels, das in ganz Süd- und Südostasien konsumiert wird – dem Betelbissen.
Die indonesische Bezeichnung Sirih Pinang weist bereits auf die beiden wichtigsten Zutaten für die Zubereitung eines solchen Bissens hin. Sirih bezeichnet das Blatt des Betelpfeffers (Piper betle), Pinang dagegen ist der harte, etwa tischtennisballgroße Kern aus der Frucht der Betelpalme (Areca catechu), den man auch als Areca- oder Betelnuss bezeichnet. Dieser Kern wird getrocknet, mit einer Betelschere in Scheiben portioniert und zusammen mit den gerollten, mit gelöschtem Kalk bestrichenen und mit einer Mischung aus Kautabak und Gewürzen versehenen Blättern des Betelpfeffers angerichtet.
In Indonesien war und ist der Betelkonsum teils noch heute mit Darreichungszeremonien zur Begrüßung von Gästen, vor allem aber mit einem Ritual bei Hochzeitsfeiern verbunden. Letzteres erklärt sich nicht zuletzt aus der Symbolik von Sirih und Pinang als den beiden unverzichtbaren Ingredienzien für den harmonischen Geschmack des Genussmittels. Damit sind sie ein Sinnbild für die gelingende Verbindung von Mann und Frau, die die Ehe leisten soll.
Heute ist der alltägliche Betelkonsum insbesondere bei der jüngeren und urbanen indonesischen Bevölkerung stark zurückgegangen. Regelmäßiger und dauerhafter Konsum führen zur Rotfärbung der Zähne und einem Zurückweichen des Zahnfleischs. Auch gilt der Konsum seit einiger Zeit als gesundheitsgefährdend.
Neben einer Betelschere gehören zu einem vollständigen Besteck auch kleine Spatel zum Stopfen der Pfefferblätter und vor allem zylindrische, bauchige oder rechteckige Kästchen oder Schatullen zur Aufbewahrung der Zutaten.
Schon vor über 60 Jahren waren Jugendliche in der Mission aktiv. Schon vor über 60 Jahren beschäftigte sich die Mission mit den auch heute aktuellen Themen Rassismus und der Auseinandersetzung mit den Religionen. Schon vor über 60 Jahren spielten Objekte und Bilder für das Verständnis von Kulturen eine Rolle.
Auszüge aus dem Jugendmissionsfest 1959 liefern Zeugnis: „Pastor Schmidt … legte seiner Predigt den Text aus Jesaja 25, 7-12 zugrunde und gab seinem Erstaunen Ausdruck, dass soviel Jugend sich versammelt habe an einem Ort, von dem man von vornherein wisse, dass es hier nur gehe um das Hören auf ein Wort, dass vor fast 2000 Jahren geredet wurde.“
Missionsdirektor de Kleine sprach über das Wort aus Apg. 1,8: „Ihr werdet meine Zeugen sein.“ Er machte die Bedeutung eines letzten Wortes an einer Erfahrung, die er in seiner langjährigen Tätigkeit auf Sumatra gemacht hat, deutlich. „Wenn Vater oder Mutter sich zum Sterben rüsten, dann versammeln sich die Kinder ums Sterbelager und bitten um ein letztes Wort. Das geht mit ihnen durchs Leben. Jesu letztes Wort ist: `Ihr sollt meine Zeugen sein.´
Nach verschiedenen Workshops, in denen die Besucher anhand von Objekten und Bildern die Missionsgebiete kennenlernen konnten, las Direktor de Kleine die Himmelfahrtsgeschichte und stellte drei Punkte heraus:
„1. Wir leben in einer Zeit großer Spannungen und Auseinandersetzungen der Rassen. Es geht um eine Zweiteilung: Weiß und Nichtweiß. Der Weiße gilt vielfach als der „Blutsauger“, der aus den Völkern des Ostens herausgeholt hat, was er gebrauchen konnte. Was hat er gebracht? … Wo ist die Klammer, die die beiden Hälften der Welt zusammenbringt?
2. Wir leben in einer Zeit ganz großer Auseinandersetzungen der Religionen. … In Bonn fragte vor kurzem ein mohammedanischer Student seinen Hausherrn, nachdem er diesen lange beobachtet hatte, zu welcher Religion er gehöre. Er bekam zur Antwort, dass er natürlich Christ sei. Auf die Frage, woran das zu merken sei, hörte er, daß der Hausherr jedes Jahr einmal, am Heiligabend, die Kirche besuche. Da meinte der Mohammedaner: „Sie haben aber eine billige Religion. Ich muss täglich fünfmal meine Gebetsübungen verrichten.“ Halten wir es auch mit der „billigen“ Religion?
3. Wir leben in einer großen Zeit, in der ganze Völker und viele Einzelmenschen sich bewußt entscheiden für oder gegen Christus. Das läßt den Gedanken lebendig werden, daß die Zeit der Wiederkunft des Herrn nicht mehr weit ist. „Christliche Jugend“, so sagte er, „die nicht wartet auf die Wiederkunft des Heilandes, entbehrt das Beste. Aber das Warten auf die Wiederkunft erfordert eine ganz konkrete Lebenshaltung. Laßt uns darum heute tun, was heute getan werden kann.“
Die VEM ist auch heute mit vielen Facetten und Sichtweisen innerhalb ihrer Gemeinschaft konfrontiert. Sich ihnen zu stellen und gemeinsam auseinanderzusetzen ist ihr ein wichtiges Anliegen.
Zentralkordillere, Luzon, Philippinen
20. Jhd.
Reis ist für die Bevölkerung im Bergland der Insel Luzon ein Hauptnahrungsmittel, aber auch ein Symbol für Wohlstand und ein gutes Leben. Die Region im Norden Luzons ist von bis zu 2000 Metern Höhe reichenden Berggipfeln, schroffen Hängen, tief eingeschnittenen Tälern und teils weiten Talkesseln geprägt. In diesem für den Ackerbau schwierigen Terrain werden die Reisfelder traditionell in einem Terrassensystem angelegt, das hinsichtlich seiner Bauweise, des Bewässerungs- und Bewirtschaftungssystems eine kulturtechnische Meisterleistung darstellt.
Ungeachtet der Tatsache, dass mehr als zwei Drittel der Bevölkerung in dieser Region heute Christen sind, haben insbesondere im Hinblick auf den Umgang mit Reis – seinem Anbau, der Ernte und Lagerung – tradierte Rituale immer noch ihren Platz. Figuren wie die gezeigte in hockender, die Arme auf die Knie gestützter Position, aber auch aufrecht stehende, die Arme seitlich herunterhängend, werden in den Reisspeichern aufgestellt. Sie sollen eine reiche Ernte, vor allem aber die sichere Aufbewahrung derselben garantieren. Diese Schutzfunktion wird durch bestimmte Zeremonien aktiviert, die von einem entsprechenden Ritualexperten durchgeführt werden. Zu diesem Zweck wird die Figur aus dem Speicher herausgetragen und der sich in ihr manifestierenden Schutzgottheit Reisbier und andere Speisen angeboten.
Das punamhan hat seinen Platz traditionell auf dem Querbalken oder Regal oberhalb der Feuerstelle des Wohnhauses. Das meist rechteckige oder quadratische, aus Narraholz (pterocarpus indica) hergestellte Kästchen wird mit einem zugehörigen Deckel verschlossen dort aufbewahrt. Anlässlich verschiedener Zeremonien wird auch dieser Behälter aus dem Haus gebracht und mit Opfergaben für die Ahnen, Geistwesen und Götter versehen, die im traditionellen Verständnis der Menschen Einfluss auf das Leben im Diesseits nehmen. Die Befüllung erfolgt je nach Ziel des Rituals mit verschiedenen Ingredienzien wie Arecanüssen, fermentierten Reiskörnern, Vogeleiern, Knochen von Kleintieren, Holzstückchen bis hin zu kleinen Figuren, die Hausgötter repräsentieren. Nach Beendigung der Zeremonie wird der Behälter wieder an seinen Platz im Haus gebracht, wo sein Inhalt verrottet bzw. durch den Rauch des Herdfeuers teils konserviert wird.
Lukas Sefu wuchs ohne Vater auf. Seine Mutter wurde nach einem Überfall mit dem Häuptling, Lukas Vater, sein Name ist unbekannt, verheiratet. Nach dem baldigen Tod des Vaters zog sie mit ihren beiden Söhnen in die Nähe der Missionsstation Hohenfriedeberg. Durch die Missionare Wohlrab und Johanssen hörten sie erstmals von Jesus Christus. Aber erst in Mbaramo lernte Lukas Sefu das Christentum kennen. In der von der Bethel Mission errichteten Schule lernte er Lesen und Schreiben. Nach schweren Schicksalsschlägen verließ er Mbaramo und ging nach Vuga. Er heiratete dort, nach dem Tod seiner ersten Frau, ein zweites Mal. Er lernte Missionar Gleiss und das Wort Gottes durch viele Gespräche kennen und, auf der Suche nach einem Sinn in seinem Leben, entschied er sich, Christ zu werden. 1907 wurde Lukas Sefu getauft. Es folgte der Besuch der Mittelschule in Lwandai. Und schließlich schickte Missionar Gleiss Sefu nach Massange, um dort eine Schule aufzubauen und als Lehrer tätig zu sein. Lukas Sefu war ein engagierter Lehrer, er sprach viel über das Reich Gottes und ward bald als Evangelist in seiner Region unterwegs. In einem Bericht beschreibt Missionar Gleiss den weiteren Weg von Lukas Sefu: „Da traf neue Not den Lukas mit uns. Durch besondere Schwierigkeiten veranlasst mussten wir gerade in jenen Tagen unsere Schule dort in Massange aufgeben … `Willst Du nach Ubili ziehen, wo schon jahrelang schwarze Lehrer gestanden haben und gelockt und gerufen, bisher vergeblich?´ `Auf, schicke mich´ war die klare Antwort. … In Ubili nahmen ihn die Leute mit Freuden auf.“ In der Zwischenzeit war das ganze Neue Testament in die Shambalasprache übersetzt worden. Lukas Sefu nutzte es intensiv für seine Predigten. Gleiss schreibt: „Am 3. September 1908, als zur Ausstellung in Vuga wohl an tausend Heiden versammelt waren, sprach unter anderen schwarzen Predigern auch Lukas Sefu, wie ihm durch des Missionars Liebe zum ersten Mal Liebe in seinem Leben aufgegangen wäre … Wie lauschte die Gemeinde an jenem Erntedankfest, als Lukas vor ihnen stand.“
Das Bild stammt aus dem Jahr 1926 bei der Taufe von erwachsenen Männern durch Lukas Sefu.
Mentawai, Indonesien
20. Jhd.
„Sago ist wie Vater und Mutter für uns“, so sagen die Menschen auf Siberut, der größten Insel des Archipels von Mentawai vor der Westküste Sumatras.
Das sagt viel über die Bedeutung der Sagopalme (Metroxylon sagu) für das Leben der Mentawaier aus. Denn das Mark der Pflanze besteht aus nahezu reiner Stärke und ist das Grundnahrungsmittel der Menschen auf dem Archipel aus dem eine Art Brot hergestellt wird. Da der Geschmack neutral ist, kann es als sättigende, kohlehydrathaltige Beilage zu einer Vielzahl an Gerichten gegessen werden.
Aber auch die weiteren Bestandteile der Pflanze finden eine vielfältige Verwendung. Mit den wasserabweisenden Fiederblättern werden die Dächer der großen, mehrere Familien beherbergenden Häuser, den uma, gedeckt. Die Rinde wird als Brennmaterial genutzt.
Aus der glatten Oberhaut der Blattspreiten werden schließlich Körbe, Matten und Koffer wie der hier gezeigte hergestellt. Die Behälter sind nicht nur robust und schützen den darin verstauten Inhalt vor Witterungseinflüssen, die angebrachten Trageriemen ermöglichen auch einen bequemen Transport über weite Strecken im oft unwegsamen Gelände auf den waldreichen Inseln. Nicht zuletzt bedingt die glatte Oberfläche des Materials schon bald eine leicht schimmernde, nachdunkelnde Patina, die den Koffer auch zu einem ästhetisch ansprechenden Gebrauchsgegenstand macht. Diese Ästhetik ist kein Zufall, da man ihr auf Mentawai ein großes Gewicht beimisst. Selbst den alltäglichsten Gerätschaften sollte auch eine ihre Funktion bekräftigende, angemessene und somit auch das Auge ansprechende Gestalt innewohnen.
Die günstigen naturräumlichen Voraussetzungen auf den Inseln, erlauben eine vergleichsweise wenig arbeitsintensive Produktion von Nahrungsmitteln, wenn die Bewohner heimische Nutzpflanzen wie Sago und Taro kultivieren und dabei auf größere Überschüsse verzichten. Das wiederum ermöglicht eine Lebensweise, die den Mentawaiern im Jahresverlauf traditionell nicht nur Freiraum für andere Betätigungen wie z.B. kreativ-schöpferische ermöglichen, sondern auch für das einräumt, was die ersten Rheinischen Missionare, die 1901 die Inseln erreichten, mit ihrer europäischen, protestantischen und damit von einem bestimmten Arbeitsethos geprägten Sozialisierung als Müßiggang verstanden. Diese Tatsache barg Konfliktpotential.
Einen erheblichen Anteil der Zeit wiederum, der nicht in die Arbeit für das Lebensnotwendige floss, investierten die Mentawaier in Rituale und über lange Perioden andauernde zeremonielle Feste, die vordringlich dem Erhalt der Gesundheit des Einzelnen und damit der uma dienten. Denn die allgemeine Lebenserwartung war vergleichsweise niedrig und das Risiko einer schweren Erkrankung mit Todesfolge auch in jungen Jahren relativ hoch. Dies hat seinen Grund wiederum ebenfalls in den naturräumlichen Voraussetzungen auf Mentawai. Klima und Naturraum begünstigen virale, bakterielle und von Protozoen verursachte Krankheiten mit oft schweren Verläufen.
1959 fragte die unabhängige Evangelische Kirche (GKI) in der damaligen holländischen Kolonie Neuguinea bei der Rheinischen Missionsgesellschaft (RMG) an, ob sie sich an der Mission im Inland beteiligen könnte.
1960 sandte die RMG den ersten Missionar nach dem holländischen Neuguinea aus. Siegfried Zöllner wurde von dem niederländischen Arzt Dr. H. Vriend begleitet. Vor Ort traten sie, gemeinsam mit dem Pfarrer Jochu und dem Evangelisten Maban die Reise ins Hochland an. Eine beschwerliche Reise über steile Hänge, sumpfiges Hochplateau und rutschigen Baumstämmen, die als Leiter an steile Felswände gelegt waren. Nach vier Tagen erreichten sie das erste Yalidorf.
Im März 1961 erreichte die Gruppe das Dorf Piliam im Yalimo-Gebiet und begann den Aufbau der Station Angguruk, in der Umgebung des Dorfes. Dort gab es die Möglichkeit, einen Landebahn für Flugzeuge zu bauen. Nach viermonatiger Bauzeit landete am 23. September 1961 die erste Cessna in Angguruk. Das Hochland war lange Zeit nur mit dem Flugzeug zu erreichen. In Angguruk entstand ein Krankenhaus mit Poliklinik, Operationsraum und Apotheke. Dr. Vriend wurde hier tätig. Weitere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der RMG folgten. So kamen mit Martha Diehl und Hanna Keßler 1963 die ersten Schwestern nach West-Papua.
1965 entstanden christliche Lieder mit Yali-Texten sowie die Lesefibel „Nare“. Gottesdienste konnten in der Yali-Sprache gehalten werden, das Neue Testament wurde übersetzt.
Seit ihren Anfängen ist die Rheinische Mission, heute Vereinte Evangelische Mission, eng mit West-Papua verbunden. Die GKI-TP ist Mitglied der VEM, das West-Papua Netzwerk ist im Missionshaus in Wuppertal ansässig.
Deutschland
20. Jhd.
Sammelbüchsen dieser Art standen bis in die 1970er Jahre in Kirchen und Gemeindesälen, um für die Mission Spenden zu sammeln.
Wahlweise Köpfe oder gefaltete Arme der Figuren sind beweglich und reagieren bei Einwurf einer Münze mit einem Schwingen. Auf diese Weise sollte der Eindruck einer Dankesgeste für die Gabe erweckt werden. Schon bald nach dem Aufstellen der ersten Büchsen fand aufgrund dieser Geste der Ausdruck „Nickneger“ weite Verbreitung in der Bevölkerung.
Als Folge des zunehmenden Bewusstseins für den diskriminierenden Charakter der Darstellungen, wurden solche Sammelbüchsen durch andere Modelle ersetzt. Heute kommen an Informationsständen und bei Veranstaltungen in der Regel neutral gehaltene, verplombte und mit dem Logo der jeweiligen Organisation versehene Standardsammelbüchsen zum Einsatz.
Seit ihren Anfängen arbeitete die Bethel Mission in Ostafrika im ärztlichen Dienst. Es entstanden zahlreiche Kliniken mit unterschiedlichen Schwerpunkten, Heilgehilfen wurden ausgebildet und die Schwestern und Missionare zogen durch die Region, um medizinische Hilfe zu leisten.
Das Bild zeigt die erste Poliklinik in Tanga im Jahr 1891. Das Ehepaar Hosbach war von 1893 mit sechsjähriger Unterbrechung bis 1949 in Tansania tätig. Martha Hosbach schreibt zu diesem Bild:
„In Tanga gab es damals noch kein Hospital, keinen Arzt, keine Schwestern. Alles was krank war kam zu uns auf die Station. Zuerst behandelten wir auf der unteren Veranda unseres Hauses, das ging aber auf die Dauer nicht gut.
Das Geld zum Bau dieser Poliklinik gaben unsere Landsleute mit Freuden. Es waren auch 2 kleine Zimmer darin für Kranke, die länger da bleiben mussten. Später bauten wir noch ein größeres Krankenhaus dazu, das auch immer belegt war. Auch zu diesem Bau gaben unsere Landsleute die Mittel gerne, wurden doch auch aus deren Betrieben die Kranken bei uns aufgenommen.
Es kamen, wie man auch auf dem Bilde sieht, allerlei Leute zur Behandlung, Inder, Araber, Suaheli, Digo u.a.m. In der Tür steht der eingeborene Helfer, ein Christ von der Universitäten Mission in Sansibar. Er hieß Samuel, er war uns eine treue Hilfe.“
Noch heute gibt es zahlreiche Krankenhäuser, deren Ursprünge in der Bethel Mission liegen.
Java, Indonesien
20. Jhd.
Seinen Ursprung hat das Instrumentenensemble Gamelan in der höfischen Tradition der javanischen und balinesischen Aristokratie und ist eng mit der Kultur und den religiösen, hinduistisch und buddhistisch geprägten Ausdrucksformen auf den zentralen Inseln des malaiischen Archipels verbunden.
In seiner Funktion ist das Gamelan in vielerlei Hinsicht mit dem Sinfonieorchester der europäischen Klassik vergleichbar. Es kommt bei reinen Musikaufführungen, zur Begleitung von Tanz und Schauspiel sowie als unabdingbarer Bestandteil religiöser Zeremonien zum Einsatz.
Doch auch die Unterschiede sind augenfällig, und gerade diese sind es, die das Ensemble und die damit verbundene Musik einzigartig machen. Jedes Gamelan-Orchester ist in seiner instrumentalen Besetzung ebenfalls einzigartig. Da jedes Instrument individuell und wiederum in Abhängigkeit von den anderen Instrumenten gestimmt ist, unterscheiden sich auch alle Orchester untereinander. Ein Austausch bzw. Einsatz eines Instruments in einem anderen Orchester ist daher kaum möglich. Diese Tatsache ist eng mit dem Aufbau eines Gamelan-Orchesters in Klangschichten verbunden. Die konotonische Schicht von sich wiederholenden, rhythmischen Zyklen, die Trommelschicht, eine starre Melodieschicht sowie eine Improvisationsschicht bilden eine komplexe Struktur sich jeweils aufeinander beziehender Einzelkomponenten. Darüber hinaus verfügt ein vollständiges Orchester in der Regel über einen doppelten Instrumentensatz. Dies ist nötig, um einem Phänomen der javanischen Musik gerecht werden zu können, das der individuellen Stimmung des Ensembles noch übergeordnet ist: die Musiker können auf diese Weise die beiden, fünf- und siebentonalen Hauptskalen der klassischen javanischen Musik mit je einem vollständigen Instrumentensatz gleichzeitig bespielen. Dies bedingt auch eine entsprechende Größe der Ensembles, die zwischen vierzig und mehr als siebzig Musikern variieren kann.
Das Gros der Instrumente in einem Gamelan-Orchester stellen verschiedene Typen von Metallophonen. Sowohl Buckelgongs in verschiedenen Formen, Größen, und Anordnungen (hängend und in hölzernen Rahmen mit jeweils definierter Größe und Anzahl zusammengefasst) als auch Instrumententypen, bei welchen Lamellen bzw. Stäbe mit Schlegeln angeschlagen werden, gehören zu einer Besetzung. Daneben kommen Trommeln, eine 26-saitige Zither Tjelempung, eine Flöte Suling und die Dornfidel rebab zum Einsatz.
Das hier zu sehende Miniaturensemble zeigt nur eine kleine Besetzung mit dem großen, an einem reich verzierten Gestell aufgehängten Gong agen im Hintergrund. Die mit viel Liebe zum Detail aus Holz gearbeiteten und bemalten Musiker und ihre Instrumente messen nur wenige Zentimeter. Sie stammen aus dem Haushalt einer deutschen Pflanzerfamilie auf Java und waren vermutlich ein nicht ganz alltägliches Kinderspielzeug.
Neuguinea, West Papua
20.Jhd.
Die Dechsel ist als klassisches Werkzeug zur Bearbeitung von Holz weniger bekannt als das Beil, wobei sie diesem nur im Aussehen, nicht aber in der Funktionsweise ähnelt.
Das anatomische Hauptmerkmal der Dechsel ist die immer in einem Neunziggradwinkel und damit quer zum Stiel stehende Klinge, die darüber hinaus leicht zum Stiel geneigt ist. Daraus ergibt sich auch ihre Handhabung. Sie wird bei der Bearbeitung des Werkstücks immer auf den Körper des Handwerkers zubewegt und ist damit in der Handhabung mit einer Feldhacke, in ihrer Wirkung aber am ehesten mit einem Hobel zu vergleichen. Die Dechsel ermöglicht das glätten auch großer Flächen und dient zur Herstellung von Brettern oder Paneelen. In Teilen Afrikas, Asiens und Ozeanien wurde und wird sie auch heute noch zur Aushöhlung massiver Baumstämme für die Herstellung von Kanus oder Schlitztrommeln benutzt. Neben der Reduktion von Masse am Werkstück, die bei diesen beiden Nutzungsmöglichkeiten im Vordergrund steht, eignet sich eine Dechsel auch für feinere Arbeiten wie beispielsweise die Einarbeitung von Mustern oder Reliefs in ein Werkstück.
Das hier gezeigte Werkzeug verfügt über eine Steinklinge, die mittels mehrfach verflochtener Rotangstränge fest mit dem Stiel verbunden ist. Es handelt sich um ein Erfolgsmodell, wie es bereits in der Jungsteinzeit weltweit in von Menschen damals bewohnten Regionen benutzt wurde.
In Neuguinea war die Steinklingen-bewehrte Dechsel beim Eintreffen der ersten Europäer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch ein Standardwerkzeug der dortigen Bevölkerung.
Die Papua kannten zum Zeitpunkt dieses Aufeinandertreffens keine Metallverarbeitung und somit auch keine aus diesem Material hergestellten Werkzeuge. Der technologische Graben zwischen den beiden Gruppen, begünstigte neben anderen kulturellen Begleitumständen generell ein Überlegenheitsgefühl der Europäer, dass vor dem Hintergrund ihrer teils kolonialen Ambitionen in der Region oft zu einer menschenverachtenden Haltung gegenüber den Papua und häufig auch zu einer dementsprechenden Behandlung der Menschen führte.
Die gezeigte Dechsel stammt aus dem Westteil Neuguineas. Erst in den 1960er Jahren kamen Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft in das dortige Hochland in die Gegend um das Dorf Angguruk. Für die ansässige Bevölkerung war es das erste Zusammentreffen mit Europäern. Aus der Missionsarbeit entwickelte sich die heute unabhängige Evangelische Kirche in Westpapua, die auch ein Mitglied der Vereinten Evangelischen Mission ist.
Christiane Mues, geb. 1800, erlebte eine schwierige Kindheit und Jugendzeit. Ihre Tätigkeit im Lehrerberuf fiel ihr nicht leicht und auch gesundheitlich war sie angeschlagen. Sie fand immer wieder Trost in ihrem Glauben.
Gustav Warneck schrieb in seiner Biographie über das Leben dieser Frau: „Es war an einem Freitag Morgen in der Passionszeit des Jahres 1832, dass der Briefträger unserer Christiane einen Brief mit dem Poststempel Barmen brachte … er enthielt nichts Geringeres als einen Heirathsantrag und zwar von einem Missionar, der eben im Begriff stand nach Afrika zu gehen.“ Christiane Kähler hatte Missionar Heinrich J. Kähler zuvor nur einmal flüchtig gesehen. Sie schreibt: „Es würde zu weit führen, wenn ich alles umständlich erzählen wollte, kurz der treue Gott hat es mir mit den Fingern gezeigt, dass ich diesem Manne angehören und mit ihm in die Heidenwelt ziehen sollte.“ Am 5. Juli 1832 fand die Hochzeit statt und bereits am 7. Juli begann das Ehepaar Kähler seine Reise nach Südafrika, dass sie, nach einigen Verzögerungen, am 3. Januar 1833 erreichten. Auf einer ersten Reise Ende Januar von Stellenbosch, das ihr Einsatzort sein sollte, nach Wupperthal zu einer Konferenz der Rheinischen Mission, ereilte Christiane Kähler ein tiefer Schicksalsschlag. Ihr Mann ertrank auf der Reise beim Baden in einem Fluss. Ihrem Schicksal ins Gesicht blickend, entschied sie sich, dennoch in Südafrika zu bleiben. Über viele Jahre war sie als Lehrerin für die einheimischen Frauen und Mädchen in Stellenbosch tätig. Sie gründete außerdem einen Missionsnähverein, dessen Resultate sie vor Weihnachten auf einem Basar zur Unterstützung der Missionsarbeit ausstellte und verkaufte. Sie kümmerte sich um Kranke und Sterbende. Schriftliche Zeugnisse ihrer Begleiterinnen zeugen von großer Übereinstimmung. Sie rühmen den Segen, „der auf den Krankenbesuchen dieser barmherzigen Schwester, dieser Diakonissin ohne Titel und Gewand“ gelegen hat. (147). Am 31. Mai 1871 verstarb Christiane Kähler im Alter von 71 Jahren in Stellenbosch.
Ihr folgten viele Ehefrauen, Schwestern und Diakonissen. Noch heute lebt der Geist von einst in der aktiven Schwesternschaft der VEM weiter.
Hongkong, China
1844
Die Druckplatte diente der Bekanntmachung der Eröffnung des ersten Krankenhauses nach den Standards der westlichen Medizin auf dem Territorium der noch nicht lange zuvor gegründeten britischen Kolonie Honkong. Es handelte sich gleichzeitig um die erste solche Einrichtung, die der chinesischen Bevölkerung uneingeschränkt offen stand.
Der Text wurde mit großer Wahrscheinlichkeit von dem britischen Arzt Benjamin Hobson verfasst, der über die London Missionary Society nach Honkong kam. Er war der Gründer des Hospitals und leitete es in den ersten Jahren. Geschichte und Zweck der Einrichtung werden auf der rechten Seite der Druckplatte thematisiert. Dort heißt es:
„Die folgende Nachricht geht an alle Einwohner von Honkong, die Bewohner von Xinan, Xiangshan, Panyu und Shunde, sowie all jene, die aus den Provinzen Guandong, Guangsi und Fujian kommen.
Das Hospital in Macao hat mit der Hilfe ausländischer Ärzte tausende von Chinesen geheilt. Dieses Krankenhaus wurde im ersten Quartal des vergangenen Jahres geschlossen. Jetzt wurde ein großes, neues Krankenhaus mit dem Namen ‚Mildtätiges Hospital‘ auf dem Hügel über dem Wong Li Chun Tal eingerichtet. Es wurde im April letzten Jahres eröffnet, um die chinesische Bevölkerung gesundheitlich zu versorgen. Die Baukosten für dieses Krankenhaus beliefen sich auf 5000 Dollar. Die gesamte Summe wurde durch großzügige Spenden von britischen und amerikanischen Kaufleuten bereitgestellt. Im Krankenhaus arbeitet ein ausländischer Arzt, und die Einrichtung bietet Platz für mindestens 80 Patienten. Das Hospital ist durchgehend geöffnet. Zwei chinesische medizinische Assistenten sind im Einsatz und bieten umfassende Behandlungsleistungen. Seit der Eröffnung des Krankenhauses suchten über 5000 Menschen (Männer, Frauen und Kinder) dort medizinische Hilfe. Von diesen wurden mehr als 800 Patienten stationär (über Nacht bzw. für mehrere Tage) aufgenommen. Die extrem armen unter den aufgenommenen Patienten, erhielten kostenfreie Speisung. Alle Patienten wurden wie Familienmitglieder behandelt. Sie wurden gleichberechtigt und ohne Ansehen ihrer Person behandelt. Alle Krankheiten, von Augenkrankheiten bis zu Hautausschlägen und –geschwüren können in dem Krankenhaus behandelt sowie medikamentöse Behandlungen und chirurgische Eingriffe durchgeführt werden.“
Auf der linken Seite der Drucktafel sind im Weiteren die Hausordnung bzw. einzuhaltende Regeln verzeichnet. Insbesondere die letzten beiden Punkte verweisen auf ein Verständnis von Diakonie, welches Richt- und Leitlinien heutiger Gesundheitseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft in dieser Form nicht entspricht. Im historischen Zusammenhang verdeutlichen sie jedoch, wie medizinische Hilfeleistung als Gebot christlicher Barmherzigkeit und Dienst am Menschen an eine Bekehrung zum Christentum im Sinne des Missionsgedankens gekoppelt werden sollte.
Dao Quang im 24sten Jahr, am ersten Tag des Septembers nach dem Mondkalender"
Der Übersetzung ins Deutsche liegt eine englische Übersetzung aus dem Chinesischen zu Grunde, die dankenswerter Weise von Iris Leung Chui Wa, Research Fellow der Tsung Tsin Mission of Hong Kong geleistet wurde.
Seine erste und einzige Inspektionsreise machte Walther Trittelvitz, Inspektor der Evangelischen Missionsgesellschaft für Deutsch-Ostafrika, EMDOA, später Bethel-Mission, nach Süd- und Ostafrika. Im August 1904 reiste er mit dem Schiff von Durban, Südafrika, über Sansibar und Daressalam nach Tanga. In Daressalam besuchte Trittelvitz den Gouverneur Deutsch-Ostafrikas, Graf Götzen. Dies war neben seiner Hauptaufgabe, dem Besuch der Stationen der EMDOA, ebenso eine Pflicht während seiner Reise.
Der gebauten Eisenbahnstrecke, die zunächst von Moshi bis Korogwe, später bis Mombo führte, stand Inspektor Trittelvitz mit geteilter Meinung gegenüber: „Am schönsten war es eigentlich, wo es keine Eisenbahnen gab … Die Eisenbahn ist ein unruhiges Übel … Sollen aber unsere Kolonien den Nutzen bringen, den das deutsche Volk von ihnen erwartet … dann wird es wohl ohne die Eisenbahn nicht möglich sein. Und da sie ja nicht nur die Güter und Waren der Kaufleute, sondern auch den Missionar mit dem Worte Gottes schnell von einem Orte zum anderen bringt, so soll sie uns willkommen sein.“
Trittelvitz reiste durch das Land, besuchte Missionsstationen und begutachtete die Arbeit auf denselben. Er beschrieb seine Reise ausführlich in seinen Tagebüchern. Auch fotografierte und entwickelte er selbst.
Nach eineinhalb Jahren in Süd- und Ostafrika trat Missionsinspektor Walther Trittelvitz seine Rückreise nach Deutschland an. Das Foto entstand an seinem Abreisetag am Bahnhof von Mombo. Trittelvitz beschreibt die Szene am Bahnhof in seinem Tagebuch: „In reih und Glied aufmarschiert steht da auf dem Platze neben dem Bahnhof eine große Schar, wohl 200 Schüler mit ihren Lehrern … wir hatten noch viel Zeit. Ich machte Aufnahmen, wir sangen und bliesen: Heil Dir im Siegerkranz und andere Lieder, und waren sehr fröhlich. Dann nahte der Augenblick der Abfahrt. Mit demselben Lied, das mir bei meiner Ankunft in Korogwe entgegenklang: `Gott ist die Liebe´, setzte sich der Zug in Bewegung.“
Von Tanga ging es mit dem Schiff am 24. August über Mombasa, durch den Suezkanal nach Genua. Am 21. September 1905 erreichte Walther Trittelvitz das Missionshaus in Berlin-Lichterfelde.
Westtansania (Kagera Region)
20. Jhd.
Die Schalen- oder Trogzithern bilden eine alte Instrumentengattung, die im zentralafrikanischen, sogenannten Zwischenseengebiet entwickelt wurden. Ihr eigentliches Verbreitungsgebiet beschränkt sich im Wesentlichen bis heute auf einen vergleichsweise schmalen Streifen, der sich in Nord-Süd-Richtung von der Südgrenze des heutigen Uganda über das Westufer des Viktoriasees in Tansania, über Ruanda und Burundi und wiederum entlang des Ostufers des Tanganyikasees bis an dessen Südspitze entlang zieht.
Das hier gezeigte Instrument weist die wesentlichen Merkmale der Gattung auf und gehört mit 66 cm Länge und 16 cm Breite zu den eher kleineren Ausführungen. Charakteristisch ist die über die ganze Länge des Instruments ausgehobene Vertiefung in Form einer Schale bzw. eines Trogs, die auch namensgebend ist. Dieser Trog bildet den Resonanzkörper des Instruments, über den die Saite verläuft. Sie wird über die je sieben Schlitze der Zahnreihen an den Schmalseiten gespannt. Somit handelt es sich um eine einzige, gut 420 cm lange Saite, deren sieben Abschnitte durch das Unterlegen eines Steges – in der Regel die Außenhaut eines Hirsestängels – nach Bedarf gestimmt werden können.
Bei alten Instrumenten diente der Trog als ausschließlicher Resonanzraum. Die rechteckige Aussparung im Zentrum des Trogs der abgebildeten Zither weist jedoch darauf hin, dass hier ein zusätzlicher Resonanzkörper verwendet werden kann oder soll. Auch handelt es sich um sehr leichtes Holz, eine Saite aus Pflanzenfaser statt der traditionell üblichen Verwendung von Leder bzw. Tiersehnen und nicht zuletzt haben auch die Brandgravuren einen historisch nicht üblichen Charakter. Die Wahrscheinlichkeit ist daher sehr hoch, dass es sich um eine Anfertigung für Touristen handelt, wobei sich eine derartige Produktion für (Durch-)Reisende in der Region bereits sehr früh etablierte und solche Stücke schon zu Beginn des Jahrhunderts einen Markt fanden.
Gespielt wird die Schalenzither mit beiden Händen in gehockter Stellung. Eine Schmalseite des Instruments weist dabei auf den Spieler, die andere liegt vom Körper des Spielers fortweisend mit der Ecke bzw. Kante auf dem Boden auf. Das Spiel war ausschließlich Männern vorbehalten und diente der Begleitung von Preisgesängen oder epischen Liedern.
Auszüge aus dem Bericht vom ersten Besuch deutscher Kinder bei König Msinga, Ruanda, 1907, ein Bericht von Missionar Ernst Johanssen
„Am 6. Juli näherte sich unsere lange Träger-Karawane der Residenz des schwarzen Herschers. Die drei Kinder, die wir mitgenommen haben, saßen fröhlich in ihren Körben … Durch einen Sumpf ging es die letzte kleine Berghöhe hinauf und nun eilte eine große Schar von Eingeborenen auf uns zu, um die Kinder zu sehen. … Sie konnten nicht nah genug herankommen, befühlten sorgsam die weichen hellblonden Haare der kleinen Adelheid und achteten auf jede Bewegung Walthers. Man konnte sich kaum ihrer erwehren, wie eine Mauer umringten sie uns. Jetzt ließ Msinga durch einen Boten sagen, wir beabsichtigten nicht bei der Residenz zu übernachten, sondern wollten uns nur einige Stunden … aufhalten, es würde uns freuen, wenn wir ihn sähen. Er ließ wieder sagen, er würde kommen. Nach einer Stunde hörten wir die Trommeln und Schalmaien … Mit Stöcken bewaffnete Diener liefen voran … um Eindruck zu machen … dem folgte der Zug der Krieger und Dienerleute Msingas in Fellbekleidung, wie ich sie schon früher beschrieben. Hinter ihnen ging der König mit der gestickten Perlenkrone, dessen Enden ihm ins Gesicht hängen, auch er in der alten Tracht, aus mit vielen herabhängenden Streifen von Fell besetzten und sehr kunstvoll zusammengenähten schmalen Lederschurzes. Wir setzten uns mit ihm an unseren Zelttisch und er erinnerte mich sofort daran, dass er mir eine Milchkuh früher versprochen habe, er gab Befehl, dass sie sogleich gebracht würde. Es war ein prächtiges Tier. Msinga mischte eine Reihe deutscher Wendungen ins Gespräch, besonders interessierte ihn die Haarfrisur meiner Frau und er fragte, wie lang ihre Zöpfe wohl seien, ob sie sie wohl einmal losbinden wolle. Auf diesen Wunsch einzugehen, lehnten wir ab, aber seine dann folgende Bitte, ihm den klappbaren Stuhl zu schenken, auf dem er saß, wurde erfüllt. … Ich gab ihm dann noch einige kleinere Geschenke, darunter die ersten Bogen einer Fibel in Kinyaruanda, enthaltend in Schreibschrift. Bruder Wohlrab hatte sie sehr sorgsam vervielfältigt, damit wir in der Lage wären, mit Schularbeit anzufangen noch vor dem eigentlichen Druck der Fibel. Msinga konnte fast alles, was darin stand, lesen. Eine halbe Stunde später machten wir ihm mit den Kindern einen Gegenbesuch. … Walter kringelte sich vergnügt auf den weichen Matten zu Füßen Msingas und sprang … Als meine Frau den König bat, sie zu der Seinigen zu führen, war er sehr verlegen, wechselte einige leise Worte zu einigen Leuten seiner Umgebung und sagte: diesmal könne es nicht sein, ein andern mal. … Um 3 Uhr brachen wir wieder auf und schlugen unsere Zelte zum letzten Mal auf der Reise auf. Ein kräftiger Regenschauer ließ uns recht mit Freude daran denken, dass wir in Zukunft ein festes Dach über uns haben würden.“
Im November 1871 wurde die Fort Wayne Organ Company in der gleichnamigen Stadt in dem US-Bundesstaat Indiana gegründet. Isaac T. Packard, Musikalienhändler aus Massachusetts, war ihr Gründer, weshalb die produzierten Instrumente von Beginn an unter der Verkaufsmarke Packard Organ vertrieben wurden.
Der sogenannte Case 450 wurde ab 1888 in Serie produziert und bis etwa in die Mitte der 1890er Jahre hergestellt. Das Design war von Stil und Geschmack der Viktorianischen Ära geprägt und fällt daher in Bezug auf die fein ausgearbeiteten Ornamente, Stege und Bordüren sehr opulent aus.
Mit dem im Museum auf der Hardt gezeigten Harmonium verbindet sich die Geschichte einer langen Reise und eines Missionars, der am Beginn des 20. Jahrhunderts für einen mehrjährigen Aufenthalt nach Südostasien entsandt wurde. Ludwig Borutta, Missionar der Rheinischen Missionsgesellschaft, nahm das Instrument vermutlich bereits bei seiner Erstausreise 1907 mit auf die kleine Insel Nias, die der Insel Sumatra im Archipel des heutigen Indonesien vorgelagert ist. Die Reise von Europa aus war zu dieser Zeit für Mensch und Instrument ein durchaus strapaziöses Unterfangen, verlief sie doch über gut 15.300 km per Schiff über das Mittelmeer, den Suezkanal und den indischen Ozean zunächst nach dem Hafen von Batavia oder Padang im damaligen Niederländisch Ostindien. Von dort musste noch die Überfahrt nach Gunung Sitoli auf Nias bewältigt werden. Und schließlich folgte der beschwerliche letzte Abschnitt der Reise über Land in den verkehrstechnisch noch wenig erschlossenen und aufgrund seiner schroffen Topographie schwer zugänglichen Süden der Insel.
Mit einigen, durch die weltpolitischen Wirren der Zeit verursachten Unterbrechungen, lebte und arbeitete Ludwig Borutta bis 1931 auf der Insel. Das Harmonium tat in diesen Jahren seinen Dienst in der noch jungen christlichen Gemeinde, die der Missionar betreute. Borutta war in vieler Hinsicht ein pragmatischer Praktiker, eine Eigenschaft, die ihm während seines Aufenthaltes in der als schwierig geltenden Region im Süden der Insel vermutlich zu Gute kam. Unter anderem richtete er die erste Mittelschule für Mädchen auf Nias ein.
Der Missionar und sein Instrument kehrten Anfang der 1930er Jahre wieder zurück nach Deutschland, nach Hiddesen bei Detmold, wo er bis kurz vor seinem Tod im Sommer 1959 in der Heimatarbeit für die Rheinische Missionsgesellschaft tätig war.
Am 5. Juni 1931 wurde die erste gehobene Mädchenschule auf Nias durch den stellvertretenden Ephorus der Niasmission, Missionar Ludwig Borutta eröffnet. Missionsschwester Hanna Blindow, seit 1930 auf Nias tätig, übernahm die Leitung der Schule. Über den Tag der Eröffnungsfeier schreibt sie: „Der Platz vor der Schule [war] bald gut besetzt … Hell erklang zu Beginn der Feier vom Posaunenchor der Seminaristen aus Ombölata die holländische Nationalhymne … Herr Missionar Ufer, der auch aus Ombölata gekommen war, sprach von den mancherlei Mühen und Arbeiten, die der Bau mit sich brachte. Er dankte allen, die sich dafür eingesetzt hatten … Nach den Ansprachen des holländischen Assistent-Residenten und verschiedener Beamten und Mitglieder der Schulkommission forderte Herr Missionar Borutta die Festteilnehmer zur Besichtigung der Mädchenschule auf.“
Die Mädchenschule umfasste vier Gebäude: die Schule mit drei Klassenräumen, einen Eßsaal, der gleichzeitig Tagesraum der Internatskinder war, einen Schlafsaal mit Nebenräumen sowie das Schwesternhaus.
Der eigentliche Schulbetrieb startete mit 36 Mädchen am 1. Juli 1931. Die Schulzeit dauerte drei Jahre. In den folgenden Jahren durchliefen zahlreiche Mädchen die Schule der Rheinischen Mission in Gunungsitoli.
Toba-Batak, Sumatra, Indonesien
19. Jhd.
Das Wort singa hat seinen sprachlichen Ursprung im Sanskrit und bedeutet Löwe. In der Mythologie der Batak bezeichnet es jedoch ein Mischwesen, dem Unheil abwehrende Kräfte und somit eine Schutzfunktion für Haus, Familie und Gemeinschaft zugeschrieben werden. In dieser Funktion nimmt es eine zentrale Stellung in der Bildwelt der Batak ein, und seine Darstellung findet sich – in der Regel als halbplastisches Relief oder vollplastisch ausgearbeitet – an vielen Gegenständen des alltäglichen, insbesondere aber des rituellen Gebrauchs. Von der in Gelbguss gearbeiteten Endung eines Armreifs, über den in Holz gearbeiteten Deckel eines Medizingefäßes bis hin zu der Stirnseite eines steinernen Sarkophags finden sich singa-Darstellungen.
Die Formensprache ist dabei in ihren einzelnen Elementen oft sehr ähnlich: eine herausgestreckte Zunge und/oder gefletschte Zähne, hervortretende große, runde Augen und ein Kopfputz oder dreigeteilter Schopf, dessen mittlerer Teil als eine Art Horn über die beiden äußeren hinausragt. Dieses Horn wird, wie die ebenfalls nahezu immer den gesamten singa-Kopf bedeckenden Blatt- und Rankenornamente, in einem Zusammenhang mit dem Weltenbaum gesehen, der wiederum ein zentrales Motiv des batakschen Schöpfungsmythos ist.
Wo immer eine Farbgebung möglich bzw. vorgesehen war, sind die singa dreifarbig gefasst und zwar in den aus entsprechenden Naturprodukten (Tonerde und Holzkohle unter Beimischung pflanzlicher Bindemittel sowie Kalk) hergestellten Farben rot, schwarz und weiß. Auch diese haben symbolische Bedeutung. So stehen sie u.a. für ein wichtiges, die bataksche Gesellschaft ganz wesentlich konstituierendes Phänomen: die jeweils eigene Familie, die Familie der sogenannten Brautnehmer und jene der sogenannten Brautgeber bilden gemeinsam ein komplexes System wechselseitiger Abhängigkeiten.
Der hier gezeigte singa-Kopf weist nahezu alle der genannten charakteristischen Merkmale auf. Auch er dürfte eine zentrale Funktion erfüllt haben. Vermutlich bildete er den Abschluss eines pandingingan. Die pandingingan sind die Balken an den Längsseiten der traditionellen Häuser der Toba-Batak. Sie tragen die mittlere Ebene des Gebäudes und somit den Wohnraum der Familien. Diesen Raum soll der so angebrachte Kopf des singa nicht nur schützen, er schaut auf diese Weise auch in Richtung der Giebelfront des Hauses. Traditionell handelte es sich bei den Dörfern in der Toba-Region um Straßendörfer, in denen alle Häuser mit ihren je nach Status der Bewohner unterschiedlich reich verzierten Giebelfronten zur Straße hin wiesen.
Neben langen Dürreperioden, die das heutige Namibia immer wieder erlebt, kam im Jahr 1932 noch eine Heuschreckenplage hinzu. Das Bild zeigt die Hauptstadt Windhoek, von Heuschrecken übersät.
Der Rheinische Missionar C. Kühhirt schreibt in seinem Bericht an die Missionsleitung in Wuppertal 1932:
„Dies Jahr kam der Regen spät und spärlich … Doch war Ostern das Feld noch grün geworden. Da sahen wir am 6. April in der Ferne mächtige, dunkle Wolken immer näher kommen. Da und dort standen Weiße und Farbige einander fragend `Was ist das? Sandsturm? Heuschrecken?´
Ja, Heuschrecken! Bald sah man Milliarden an Windhuk vorbeifliegen. In Gärten und auf Farmen haben sie viel abgefressen. Viele hungrige Eingeborene sammelten jubelnd Säcke voll Heuschrecken und sagten: `Da schickt uns der liebe Gott leckere Kost vom Himmel. Nun sind wir Monate versorgt und werden fett. Das ist die beste Speise in der Welt´.
Durch dies Erlebnis wurden wir an die Heuschreckenplage erinnert, die der Profet Joel berichtet: ´Wachet auf, ihr Trunkenen, und weinet. Denn es besucht herauf in mein Land ein mächtig Volk ohne Zahl. Das hat Zähne wie Löwen. Dasselbige verwüstet meinen Weinberg, und streifet meinen Feigenbaum ab und schält ihn, dass seine Zweige weiss dastehn. Das Feld ist verwüstet, und der Acker stehet jämmerlich, und das Getreide ist verdorben. Die Ackerleute sehen jämmerlich, und die Weingärtner heulen´.
Ja, Gottes Gerichte gehen auch über Südwest Afrika: Dürre, Heuschrecken, Geschäftskrise und Arbeitslosigkeit und Grippe.“
Tansania, Usambara Region
19. Jhd.
Im 17. Jahrhundert etablierte sich im Bergland der Usambara Region im Nordosten des heutigen Tansania das Königreich Kilindi. Regierungssitz des simba mwene (Löwenkönig) war der noch heute existierende Ort Vuga. Aufgrund der günstigen klimatischen Voraussetzungen für ertragreichen Ackerbau war die Bevölkerungsdichte in den Usambara Bergen schon damals vergleichsweise hoch, und die ansässigen Shambaa lebten weitgehend von der Subsistenzwirtschaft. Aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte war jedoch auch die Arbeitsteilung innerhalb der Gesellschaft ausgeprägt. Insbesondere gab es professionelle Handwerker, die die Menschen in den Dörfern und Weilern mit den Geräten des alltäglichen Bedarfs versorgten. Eine besondere Stellung hatten die Schmiede inne, die sich neben der besonders bedeutenden Eisenverarbeitung auch in der Herstellung der Schilde für die Krieger der Shambaa betätigten.
Diese Schilde sind extrem widerstandsfähig, da sie aus Rhinozeroshaut gefertigt und mit einer über die gesamte Länge der rückwärtigen Seite laufenden hölzernen Stange verstärkt sind, die wiederum durch ein Geflecht aus reißfesten Lederriemen am Schild fixiert ist. Das Zurichten der Häute selbst ist aufwändig, da die in entsprechender Größe geschnittenen Partien intensiv mit Palmöl eingerieben und dann über dem offenen Feuer ausgehärtet werden. Durch diesen Vorgang entsteht auch die charakteristische Riffelung, die den Schild wie ein filigranes Muster überzieht.
Mit einer Höhe von 50 bis 60cm und einer Breite von etwa 25cm sind die Schilde darüber hinaus relativ kompakt, nicht besonders schwer und daher für Manöver im Kampf flexibel handhabbar.
Bei Ankunft der ersten Europäer in der Region hatte das Königreich Kilindi seinen Zenit bereits überschritten, und am Ende des 19. Jahrhunderts wurden Schilde dieser Art nicht mehr hergestellt.
Auch evangelische Missionsgesellschaften produzierten in den 20er und 30er Jahren des 20. Jahrhunderts aus ihrer Feldarbeit heraus Filme, die bis in den 2. Weltkrieg eingesetzt wurden. Vorgeführt wurden die Filme in der Regel im Zusammenhang mit Missionsvorträgen. Typisch für fast alle Filme ist ihr eher pseudo-dokumentarischer Charakter, der dem Zuschauer ein idealisiertes Bild der Missionswirklichkeit vorhält. Die dramaturgischen Konzeptionen der Filme und die Art ihres Einsatzes in den deutschen Kirchengemeinden zielten darauf ab, über die Weckung von Emotionen Enthusiasmus für die Sache der Mission und die Missionare zu wecken.
Der Film „Sieg des Evangeliums im Lande der Kopfjäger“ aus dem Jahr 1934, zeigt den Missionsaufbau der Rheinischen Mission auf Nias, Indonesien.
Der Missionar E. Denninger, einer der Überlebenden der auf Borneo angegriffenen Missionare, begegnete auf Sumatra den ersten Niassern. Er fasste den Entschluss, nach Nias überzusiedeln und gründete 1865 die Missionsstation in Gunungsitoli.
Es herrschte viel Krieg und Kampf auf der Insel, die sogenannten Kopfjäger versetzten Einheimische in Angst. Es dauerte eine lange Zeit, bis Rheinische Missionare ihre Arbeit ausdehnen, weitere Missionsstationen auf der gesamten Insel aufbauen und Niasser zum Christentum führen konnten. Nach 25 Jahren Missionstätigkeit waren 770 Menschen getaufte Christen. Um 1900 war die Zahl auf 5000 angestiegen. Eine starke Entwicklung gab es nach der Zeit der „großen Reue“, die 1916 ihren Anfang nahm und in der Tausende ihre Sünden bekannten und zum lebendigen Glauben an Christus kamen. 1926 war die Zahl der Getauften auf 65 000 gestiegen.
Wie andere Missionsfilme so war auch der Film über die Missionsarbeit auf der Insel Nias ein Werbemittel, um die Spendenbereitschaft der Gemeindemitglieder zu fördern. Durch Visualisierung der Missionswirklichkeit das Bewußtsein der Zuschauer für die Arbeit der Missionsarbeit unter Einschluss der Bildungs- und Sozialarbeit sowie der eigentlichen Verkündigungsarbeit des Missionars zu wecken, darum ging es.
Die bewegten Bilder wurden erfolgreich eingesetzt. Und ließen den Nickneger eifrig den Kopf nicken.
Namibia oder südliches Angola
19. /Anf. 20. Jhd.
Lamellophone bilden eine sehr variantenreiche und alte Musikinstrumentengattung, die nahezu überall in Afrika südlich der Sahara verbreitet ist. In Europa kannte man historisch keinen vergleichbaren Instrumententyp, sodass sich bei den ersten europäischen Reisenden auf dem Kontinent bald der Begriff Finger- oder Daumenklavier einbürgerte. Diese Bezeichnung spiegelt in gewisser Weise die Unbeholfenheit bei der Einordnung des Instruments wider, da sie lediglich auf das äußere Erscheinungsbild der ‚Tasten‘ und ihre Bedienung durch den Andruck mittels der Finger abhebt. Bautechnisch und insbesondere, was die Klangerzeugung betrifft, verbindet die Lamellophone jedoch kaum etwas mit dem Klavier.
Die Lamellophone lassen sich im Hinblick auf die Beschaffenheit ihrer Lamellen in zwei große Gruppen unterscheiden. In Westafrika und dem nördlichen Zentralafrika waren und sind die Lamellen aus den harten Blattstielen der Raphiapalme (raphia regalis) oder Bambus gefertigt, während im südlichen und östlichen Afrika sowie im südlichen Zentralafrika Eisen als bevorzugtes Material genutzt wurde und wird.
Das hier gezeigte Lamellophon verfügt über 11 Eisenlamellen, die über einem ebenfalls aus Eisen gefertigten Steg geführt sind und durch einen über vier Krampen auf dem Brett befestigten Druckbalken fixiert werden. Der hölzerne Korpus ist fächerförmig gearbeitet und hat seitlich erhöhte Randwülste die über das zum Körper des Spielers weisende Ende zusammenführend aus dem Holz gearbeitet wurden, sodass kein zusätzlicher Hintersteg benötigt wird, da die Lamellen an ihrem oberen Ende direkt auf dem Rahmen aufliegen. Auf dem Foto nur andeutungsweise erkennbar ist ein mittig im Korpus eingefügtes rundes Schallloch. Es weist darauf hin, dass das Instrument eigentlich unvollständig ist, bzw. gespielt wird, indem man es auf die aufgeschnittene Hälfte eines Kalebassenkürbisses als Resonanzkörper auflegt, oder es in diese hinein hält. Die Lamellen werden bei diesem Modell ausschließlich mit den Daumen betätigt.
Historisch eignete sich das ansonsten relativ kleine, handliche Instrument besonders gut für Menschen, die häufig und über weite Strecken unterwegs waren. Damit fand es vermutlich auch im Zusammenhang mit der europäischen Expansion durch Forschungsreisende, Vertreter der Kolonialverwaltungen, Händler und Missionare einen verstärkten Einsatz und eine weite Verbreitung. Als kompaktes Instrument mit wenig Gewicht war es ein passender Begleiter für Wanderarbeiter und die für Trägerdienste in den Karawanen von Europäern oder Arabern rekrutierte Bevölkerung in der zweiten Hälfte des 19. und ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Die Unterbarmer Hauptkirche in Wuppertal war und ist seit Gründung der Rheinischen Mission ein wichtiger Verbindungsort zwischen Gemeinde und der Mission. In dieser Kirche wurden die Missionare und Schwestern feierlich in ihren Dienst der äußeren Mission entsandt.
Das Bild zeigt den Gottesdienst während des Missionsfestes im August 1871, der, umrahmt von einer ganzen Festwoche, den Höhepunkt in eben dieser bildete. In den Berichten der RMG heißt es:
„Lange vor Beginn des Gottesdienstes waren die Räume der Unterbarmer Hauptkirche gefüllt. Es war eine wahre Lust zu sehen, wie während des halbstündigen Geläutes die Züge derer, die mitfeiern wollten, von allen Seiten zum Hause des Herrn strömten. Die Feier am Morgen währte von 9-12 Uhr, aber ich habe nicht gesehen noch gehört, dass es jemand zu lang und zu viel geworden.“
Die Festpredigt hielt Pfarrer Blumhardt aus Bad Boll. Als Text lag ihr zu Grunde Lukas 11, 1-2:
„Und es geschah: Jesus betete einmal an einem Ort; als er das Gebet beendet hatte, sagte einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger beten gelehrt hat! Da sagte er zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme.“
Es folgte die Ordination von fünf Männern, die nach Namibia, Indonesien und Süd-Brasilien ausgesendet werden sollten. Nach der Ordinationsrede durch den Superintendenten der Elberfelder Kreissynode folgte der eigentliche Ordinationsakt: „…dann knieten sie nieder, um unter Handauflegung die Weihe zu ihrem heiligen Amte zu empfangen. Es herrschte eine lautlose Stille in der großen Versammlung und geschah unter vieler Bewegung der Gemüther…“.
Am Nachmittag schloss sich ein Missionsfest auf dem Kirchvorplatz an, an dem die Mission ihre Arbeit in den unterschiedlichen Missionsgebieten vorstellte.
Bis heute ist die VEM eng mit der Gemeinde und der Kirche verbunden.
China, Anf. 20. Jhd.
Der Urin von Jungen, die noch nicht die Pubertät erreicht hatten, wurde in der traditionellen chinesischen Medizin in eigens zu diesem Zweck hergestellten Gefäßen gesammelt. Als Ingredienz mit weiteren Substanzen vermischt, kam er im Rahmen verschiedener medizinischer Anwendungen zum Einsatz. Paul Unschuld dokumentiert in seiner Publikation Huichun – Rückkehr in den Frühling: Chinesische Heilkunde in historischen Objekten und Bildern, München, New York 1995 (S.23) die folgenden weiteren Substanzen, die für eine Mischung mit Knabenurin in Frage kommen: Schweinefett, Galle, menschliche Spermaflüssigkeit, Tierblut, Hühnerei, Reiswaschwasser, Schildkrötenhirn, Wagenfett und ‚Fett vom menschlichen Kopf‘. Die durch das Anrühren gewonnenen Medien konnten in Sitzbädern oder Waschungen, aber auch als Bindemittel für Salben zur äußerlichen Anwendung oder für die Herstellung von Pillen zur Einnahme verwendet werden.
Das auf der Oberseite lasierte Gefäß aus Steingut verfügt über eine geweitete Öffnung, die sowohl das Sammeln als auch das spätere Ausgießen des Urins in Tiegel für die Weiterverarbeitung erleichtert. Der unmittelbar darüber angebrachte Griff ermöglicht den sicheren Transport.
Die nach China entsandten Missionare der Rheinischen Missionsgesellschaft, die in Barmen ihren Sitz hatte, insbesondere aber ihre Mitarbeiter im sogenannten missionsärztlichen Dienst, waren mit der dort praktizierten Medizin und ihren Heilmethoden konfrontiert. Die von den Missionsärzten eingeführte sogenannte westliche Medizin führte zunächst zu einem Nebeneinander beider, in mancher Hinsicht konkurrierenden Systeme.
Anerkennung fand die importierte Medizin besonders durch die Einrichtung von nach damaligen Standards modernsten Missionskrankenhäusern (z.B. in Tungkun 1888). Dort konnten nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen erfolgreich medikamentöse Behandlungen, vor allem aber auch chirurgische Eingriffe durchgeführt werden. Letzteres ist in der traditionellen chinesischen Medizin kaum verbreitet. Erst im Lauf der Zeit erlangten auch bestimmte Praktiken der chinesischen Medizin Anerkennung bei europäischen und amerikanischen (Missions-)Medizinern wie Akupunktur, Akupressur, Diätik und Bewegungsübungen.
Vor dem Haus des Älteren Boum auf Dampier
Nach langer Schifffahrt über Hongkong erreichte Missionsinspektor Eduard Kriele mit seiner Begleitung zu Ostern Neu-Guinea. Per Boot, Pferd und zu Fuß besuchten sie verschiedene Stationen der Rheinischen Mission. Im Norden der Dampier-Insel trafen sie auf Boum, Ältester eines Dorfes inmitten der Insel. Seine Hütte zeichnet sich aus durch drei übermannshohe, grob geschnitzte Götzenbilder (eines zu sehen im Bild links). Kriele schreibt: „Zum Zeichen, dass wir ihm willkommen waren, trug er zwei Matten heraus und lud uns zum Sitzen ein … Tabak, den es dort viel geben muss, wurde in ganzen Bündeln herbeigeschafft. Die Männer drehten uns Zigarren … und so rauchten wir und unterhielten uns wohl eine ganze Stunde lang. Aber wie! Die Sprache dort war unseren Missionaren unbekannt, und doch haben wir uns gegenseitig verständigen können. Die Unterhaltung bestand nämlich einfach darin, dass wir uns von Zeit zu Zeit unsere Namen zuriefen. „Oh Helmich!“ – „Oh Boum!“ – „Oh Kriele!“ usw. und dabei allerhand unartikulierte Töne von uns gaben. Aber der Zweck war erreicht; wir schlossen Freundschaft miteinander … Am anderen Tage kam Boum noch nach dem Stranddorf hinunter, in dem wir übernachtet hatten, um sich von uns zu verabschieden.“
Eduard Kriele reiste, wie viele Missionsinspektoren vor und nach ihm auf sogenannten Inspektionsreisen, noch weiter durch Neu-Guinea. Er illustrierte zahlreiche Berichte, nicht nur für die Rheinische auch für andere evangelische Missionsgesellschaften.

Insel Nias, Indonesien, 19. oder Anf. 20. Jhd.
Töla zaga bezeichnet ein Schmuckstück, das in der Regel von Männern aus dem Adel zu bestimmten Anlässen am rechten Oberarm getragen wurde. Gelegenheiten für das Tragen der massiven, aufwändig gearbeiteten Armringe waren Feste wie Rechtsfeste, Namensfeste oder Feste, die im Zusammenhang mit der Erhöhung des Ranges eines Angehörigen der Oberschicht standen.
Überliefert ist außerdem ein Anlegen des Armschmucks im Rahmen von Hochzeitsfeiern.
Das in der Anmutung an Elfenbein erinnernde Material zur Herstellung der Armreifen wurde aus der Schale der großen Riesenmuschel (Tridacna gigas) gewonnen. Die zur Familie der Herzmuscheln zählende Art lebt auf Korallenriffen im gesamten indopazifischen Raum und kann ein Gewicht von bis zu 400 kg erreichen. Heute ist die Art vom Aussterben bedroht.

Lina Stahlhut mit einer Hererofrau, um 1910
1895 erreichte die 22jährige Lina Rohde die Kolonie Deutsch-Südwestafrika und heiratete im Januar 1896 auf der Missionsstation Otjimbingue den rheinischen Missionar Wilhelm Stahlhut. Fortan lernte sie die Sprache der Ovambo, unterrichtete Frauen in der Nähschule und kümmerte sich um Kranke. Schwere Schicksale ereilten sie. Sie verlor ihre drei Kinder in jungen Jahren, ihr Mann verstarb bald an Schwarzwasserfieber. Und dennoch, ihr starker Glaube half Lina Stahlhut, ihren Weg weiter in Südwestafrika zu gehen.
Als Missionsschwester arbeitete sie zunächst in Ondjiva, nach einem Heimaturlaub wurde sie auf der Station Karibib eingesetzt. Dass sie nicht mehr unter den Ovambo leben und arbeiten durfte, traf sie sehr. In Karibib kümmerte sie sich um die Pflege der Kranken, war beteiligt an den Sonntagsschulen und nahm sich der Kinder und Frauen der Herero an. Nachdem Südwestafrika englisches Mandatsgebiet geworden war, erhielt Lina Stahlhut die Aufsicht über 600 Schüler und einheimische Lehrer in den Missionsschulen. 1929 bat sie um Entlassung aus dem Schuldienst. 1933 kehrte Lina Stahlhut aus gesundheitlichen Gründen ganz nach Deutschland zurück, wo sie noch im gleichen Jahr verstarb.
Vortrag von Christoph Schwab im Klingenmuseum Solingen am 17. März 2020, 18.00 Uhr - ABGESAGT
Eine direkte Verbindung zwischen dem Bergischen Land und Indonesien besteht schon seit dem 19. Jahrhundert: Die Rheinische Missionsgesellschaft bemühte sich dort um die Verbreitung des christlichen Glaubens.
Hierüber spricht Ch. Schwab, Kurator des Museums auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, am Dienstag, den 17. März 2020 um 18.00 Uhr im Klingenmuseum Solingen.
Der Vortrag findet im Rahmen der Sonderausstellung "Stahl und Zauber. Klingen des Malaiischen Archipels" des Themenjahres der Bergischen Museen statt. Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM ist Mitglied und zeigt derzeit die Ausstellung "Erst die Arbeit, dann die Mission".

Bedingt durch ihren Auftrag, neben dem Christentum ebenfalls westlich-europäische Bildung und Knowhow zu verbreiten, berührte die Bethel Mission nicht nur das religiöse Leben der in Deutsch-Ostafrika lebenden Gruppen. Unter anderem errichtete die Bethel Mission außerdem handwerkliche Betriebe. Dort bildeten deutsche Handwerksmeister Lehrlinge aus der Gesellschaft der Shambaa an aus Deutschland importierten Maschinen aus. Was waren sowohl Inhalte als auch Auswirkungen dieser Ausbildungsbetriebe? Auf diese und weitere interessante Fragen geht der Vortrag ein.
Referent: Christian Froese, Leiter des Schriftarchivs der Archiv- und Museumsstiftung der VEM
Der Eintritt ist frei
Ausstellung: Deutsche Missionsarbeit in Afrika. Ein Beitrag von Dr. Brigitta Hildebrand
ABGESAGT
Zum nun schon dritten Mal laden wir herzlich ein zum Neujahrskonzert der Archiv- und Museumsstiftung der VEM.
Am Sonntag, den 12. Januar 2020 um 11 Uhr im Museum auf der Hardt, steht das Neujahrskonzert in diesem Jahr unter dem Thema "Wandeln, Hören, Sehen."
Wie klang die Arbeit der Missionare und Missionarinnen? Auf diese Frage gibt das Neujahrskonzert musikalische Antworten. Der Wuppertaler Musiker Andre Enthöfer wird auf verschiedenen Instrumenten das Thema vorstellen. Mehrstimmig und vielschichtig wandelt er zwischen den Kulturen, mischt, kontrastiert und lässt die Arbeit der Mission in einem anderen Licht erklingen.
Das Neujahrskonzert ist abgestimmt auf die derzeitige Sonderausstellung im Museum auf der Hardt "Erst die Arbeit dann die Mission" als Teil des Themenjahres "Ganz viel Arbeit" der Bergischen Museen.
Wir bitten um verbindliche Anmeldung bis Mittwoch, 8. Januar 2020 unter
Tel:0202-89004-151
Eintritt: 15 €

Kaffee und Kuchen waren die Beilage. Im Hauptgang servierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Archiv- und Museumsstiftung der VEM gut fünfundzwanzig Gästen im Museum auf der Hardt Texte aus zwei Jahrhunderten Missionsarbeit. Die Briefe und Berichte von Männern und Frauen im Dienst der Rheinischen Missionsgesellschaft und der Bethel Mission lieferten erheiternde, informative und teils auch nachdenklich stimmende Einblicke in Leben und Arbeit für die Missionsbewegung. Ihre Verfasser und Verfasserinnen schrieben aus den Missionsgebieten in Afrika und Asien oder auch aus den Mutterhäusern der beiden Gesellschaften für ihre Unterstützergemeinden im Bergischen Land, Westfalen und darüber hinaus.
Den roten Faden durch die Lesung bildeten die Stationen der aktuellen Sonderausstellung „Erst die Arbeit, dann die Mission“: von den Vorarbeiten zur Verbreitung des Christentums, dem Erlernen und der Übersetzung der Bibel in die jeweils lokalen Sprachen über den Schul- und Ausbildungsbetrieb auf den Missionsstationen bis hin zum sogenannten Missionsärztlichen Dienst. So erfuhren die Zuhörer und Zuhörerinnen schließlich auch, wozu die Behandlung einer fiebrigen Erkrankung mit einfachsten Mitteln durch einen Missionar in Papua Neuguinea führen konnte. Denn die mit seiner Frau durchgeführte Schwitzkur, veranlasste einen „jungen Papuachrist“ wie es in der Anekdote im „Kleinen Missionsfreund“ aus dem Jahr 1924 heißt dazu, sich die Behandlung des „Auskochens“ durch den Missionar abzuschauen, um sie dann bei anderen Erkrankten in seiner Gemeinde selbst anzuwenden.
Die Veranstaltung war Teil des Themenjahrs „Ganz viel Arbeit“ 2019/2020, eines Kooperationsprojekts von 11 Bergischen Museen. Das Projekt befasst sich mit dem Thema Arbeit aus den verschiedenen Perspektiven der teilnehmenden Häuser und wird gefördert durch den Landschaftsverband Rheinland und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Dienstag, 19. November 2019, 16.00 Uhr
Eine Lesung im Rahmen der Sonderausstellung
Erst die Arbeit, dann die Mission - Der Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika und Asien als Teil des Themenjahres„Ganz viel Arbeit“ der Bergischen Museen.
Eine Veranstaltung im MUSEUM AUF DER HARDT
Die Mitarbeiter der Archiv- und Museumsstiftung der VEM servieren Ihnen an der kleinen Kaffeetafel Heiteres, Besinnliches und Informatives aus historischen Texten zum Thema Missionsarbeit über Zeiten und Kontinente hinweg.
Zur Lesung in den Räumen des Museums auf der Hardt laden wir Sie ganz herzlich ein.
Museum auf der Hardt, Missionsstraße 9, 42285 Wuppertal
Wir erbitten Ihre Anmeldung bis Freitag, 15. November 2019, an ams[at]vemission.org oder per Telefon: 0202-89004-152
„Der eigentliche Schlüssel für die Arbeit von Missionaren und Missionsschwestern war die Sprache“, sagte Christoph Schwab von der Archiv- und Musemsstiftung der VEM gestern anlässlich der Eröffnung der Sonderausstellung im Museum auf der Hardt in Wuppertal. „Erst die Arbeit, dann die Mission – Der Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika und Asien“ so der Titel der Ausstellung. Nicht die eigene Sprache sei gemeint, sondern die der „Anderen“, die Sprache der Menschen, zu denen sie kamen in Afrika, Asien und Ozeanien, betonte der Stiftungskurator. „Denn wer von seinem Gott nicht nur predigen, sondern auch verstanden werden wollte, der musste seine Zuhörerinnen und Zuhörer nicht nur verstehen, sondern auch sprechen.“ Die Ausstellung will Aufschluss geben über die Bedeutung des Schlüssels. Dazu gehöre auch die komplexe Vorarbeit zur Umsetzung der eigentlichen Aufgabe, für die die Missionare und Missionsschwestern entsandt worden waren – nämlich die Verbreitung des Christentums, so Schwab.
In mehreren Vitrinen werden rund ausgewählte Exponate präsentiert, darunter Bücher, Fotos, Zeichnungen und Alltagsgegenstände von Missionaren und Missionsschwestern wie etwa ein Holzschemel. Das Sitzmöbel wurde um 1908 in einer Schreinerei der Bethel Mission in der Usambara-Region hergestellt. Eine Schaufensterpuppe aus Pappmaché präsentiert anschaulich die Arbeitskleidung einer Schwester der Rheinischen Missionsgesellschaft: ein dunkelblaues Kleid mit Pelerine, weißem Kragen und weißer Haube. Auch ein Fotoalbum, das die Arbeit auf Sumatra zwischen 1922 und 1961 festhält, ist dabei. Ein kleines Tongefäß, ein Ofen aus Lehm, hinter Glas spannt einen Bogen in die Gegenwart. Dieses Exponat weist auf ein Projekt nachhaltiger Entwicklung der Anglikanischen Kirche in Ruanda hin, heute eine Mitgliedskirche der VEM. Die Sonderausstellung gibt einen intensiven Einblick in den Arbeitsalltag der Rheinischen Missionsgesellschaft und der Bethel Mission – fern der Heimat. Und sie zeigt, wie sich die Missionsarbeit von damals verändert hat und welche Arbeitsschwerpunkte die Nachfolgeorganisation der beiden Gesellschaften heute setzt.
Es sei ihr eine große Freude, stellvertretend für den Arbeitskreis Bergischer Museen das Grußwort zu sprechen, sagte Dr. Yvonne Gönster. Zu dem 2016 gegründeten Arbeitskreis Bergische Museen gehören zahlreiche Museen der Region; auch das Museum auf der Hardt in Wuppertal. Gemeinsam könne man mehr erreichen, sagte sie. „Denn jedes Museum hat es nicht leicht, sich Gehör und Aufmerksamkeit zu verschaffen. Wenn man sich zusammenschließt, kann man nicht nur lokal, sondern auch überregional Besucherinnen und Besucher für sich gewinnen“, sagte die wissenschaftliche Mitarbeiterin des Deutschen Schloss- und Beschlägemuseums in Velbert. So kam es schließlich zur Zusammenarbeit. Das Themenjahr „Ganz viel Arbeit“ sei das erste größere Projekt dieses Arbeitskreises. Elf Museen der Region haben von Juni diesen Jahres bis Mai 2020 ein vielfältiges und umfangreiches Programm zusammengestellt, das begleitet wird von zahlreichen Führungen, Konzerten, Vorträgen und Lesungen. Auch eine klassische Bergische Kaffeetafel sei dabei, versichert Gönster. Das Themenjahr „Ganz viel Arbeit“ ist auch im Internet: www.bergischemuseen.de.
Aufgelockert wurde der Nachmittag mit Wolfgang Reimers am E-Piano. Der freischaffende Komponist und Pianist aus Wuppertal spielte unter anderem Stücke von Tom Wiggins, einem US-amerikanischen Komponisten aus dem 19. Jahrhundert.
Am Eröffnungstag besuchten rund 40 interessierte Gäste die Sonderausstellung „Erst die Arbeit, dann die Mission – Der Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika und Asien“.
Das Projekt wird gefördert durch den Landschaftsverband Rheinland und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen sowie acht Förder- und Trägervereine Bergischer Museen.
Erst die Arbeit, dann die Mission – Der Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika und Asien
Das Museum auf der Hardt in Wuppertal eröffnet am 27. Oktober eine Sonderausstellung zum Themenjahr der Bergischen Museen
Wie arbeiteten Missionsschwestern und Missionare? Wohin wurden sie entsandt? Welche Vorarbeiten gab es zu erledigen, bevor sie ihre eigentliche Aufgabe, die Verbreitung des Christentums beginnen konnten? Welcher Mittel bedienten sie sich zur Umsetzung dieser Aufgabe? Wer arbeitete wie an diesem Vorhaben mit, und was ist schließlich aus dieser Arbeit geworden? Und können Dinge wie eine alte Nähmaschine, ein kleines Tongefäß oder ein dunkelblaues Kleid darüber Auskunft geben?
Die Ausstellung befasst sich mit diesen Fragen und gibt anhand von ausgesuchten Exponaten Einblicke in die Arbeit der Rheinischen Missionsgesellschaft und der Bethel Mission. Auch die ärztliche Gesundheitsversorgung, das Werkstätten-, Schul- und Ausbildungswesen sowie Sprachstudien und deren praktischer Nutzen werden thematisiert. Nicht zuletzt spannt die Ausstellung einen Bogen in die Gegenwart. Sie zeigt auf, wie sich die Missionsarbeit von damals verändert hat und welche Arbeitsschwerpunkte die Nachfolgeorganisation der beiden Gesellschaften heute setzt.
Dr. Yvonne Gönster vom Deutschen Schloss- und Beschlägemuseum in Velbert wird für die Bergischen Museen ein Grußwort halten. Christoph Schwab, Kurator des Museums auf der Hardt, führt ein in die Sonderausstellung.
Das Projekt wird gefördert durch den Landschaftsverband Rheinland und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen.
Zeitgleich präsentiert das Museum anlässlich des 2020 in Wuppertal stattfindenden Engels-Jahres die Verbundenheit der Familie Engels mit der Wuppertaler Mission sowie mit der Unterbarmer Hauptkirche, wo die Missionare und Missionarinnen mit der Gemeinde ihre Aussendung feierten.
Eröffnungim Museum auf der Hardt
Missionsstraße 9 ∙ 42285 Wuppertal
27. Oktober 2019, 16 Uhr - Wir bitten um Anmeldung bis zum 23.10.2019
Dauer der Ausstellung
27. Oktober 2019 – 30. April 2020
Während der Sonderausstellung gelten erweiterte Öffnungszeiten:
jeden 1. und 3. Sonntag im Monat 14-17 Uhr
mittwochs 10-13 Uhr sowie auf Anfrage
Das Themenjahr im Internet: www.bergischemuseen.de
Interessiert und berührt waren die Kinobesucher nach der Vorführung des Films von Hans-Peter Lübke.
Im Cinema Wuppertal zeigte die Archiv- und Museumsstiftung der VEM inmitten der Stadt gemeinsam mit Hans-Peter Lübke seinen Dokumentarfilm.
Auf der Suche nach Paul – ein sehr persönlicher Film, der den Weg Lübkes in Namibia zeigt, auf der Suche nach seinem Freund Paul aus Kindertagen. Hans-Peter Lübke ist ein Kind der Mission. Sein Vater wurde 1959 von der Rheinischen Missionsgesellschaft als Theologe nach Namibia ausgesandt, Lübke jun. verbrachte dort die ersten 10 Lebensjahre. Die Freundschaft zu Paul hat er nicht vergessen, und das wird in seinem Film sehr deutlich. Ihm war es ein Bedürfnis, das wiederentdeckte Foto von Paul und ihm nicht nur mit Gedanken in die Vergangenheit wieder zur Seite zu legen. Er wollte Paul treffen, sehen, wie es ihm nach über 45 Jahren geht, ob er noch lebt.
Sie treffen sich wieder, ein bewegender Moment im Film, der auch die Zuschauer ergreift. Dann zeigt der Film, wie Paul heute lebt, die beiden Männer Seite an Seite. So wie in Kindertagen.
Am 29. Juli 2019 fand die Einweihung des neuen VEM-Büros der Region Asien in Pematangsiantar durch den Moderator, Dr. h.c. Willem Simarmata, statt. An der Veranstaltung nahmen zahlreiche Gäste und Mitglieder des VEM-Vorstands teil.
Das neue Bürogebäude wurde nach zeitgemäßen Gesichtspunkten konzipiert. Die Architektur ist die gekonnte Verschmelzung des traditionellen Batak-Stils mit modernen Stilelementen. Das Gebäude umfasst ein Erdgeschoss und ein erstes Stockwerk. In dem 320 m2 großen Erdgeschoss befinden sich das Arbeitsbüro, der Personalbesprechungsraum mit dem Raum des Büroleiters, die Lobby, Bibliothek, das VEM-Archiv, der Ausstellungsbereich, der Speiseraum sowie der Serverraum und das Lager.
Der Eingangs- und Ausstellungsbereich wird zukünftig um Objekte und Dokumente aus der Archiv- und Museumsstiftung der VEM ergänzt.
Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM versteht sich als das Gedächtnis der VEM-Geschichte für die Gegenwart. Das Museum auf der Hardt ist das Museum aller Mitglieder der VEM. Jetzt wurden unter dem Thema „Musik verbindet“ historische Schalmeien, Gesangbücher und Fotografien musizierender Gemeinden aus Tansania, Indonesien, China und Deutschland als Dauerleihgaben dem Leiter des Büros, Petrus Sugito, als Zeichen der Verbundenheit in der VEM, übergeben.
Trotz eher trüben Wetters war die Hardt rund um den Elisenturm wieder gut besucht. Besucher aus Wuppertal und Umgebung schlenderten entlang der zahlreichen Stände, informierten sich, kauften Handwerk und unterstützten damit den Botanischen Garten, Veranstalter des alljährlichen Festes, der in diesem Jahr sein 25jähriges Bestehen feiert.
Am Stand der Archiv- und Museumsstiftung der VEM und VEM informierten sich die Besucher über das Freiwilligenprogramm der VEM, über das Museum auf der Hardt und das neue Kooperationsprojekt www.bergischemuseen.de, an dem auch die Archiv- und Museumsstiftung der VEM teilnimmt. Das gemeinsame Themenjahr „Ganz viel Arbeit", das bis Mitte 2020 läuft, vereint zahlreiche bergische Museen, die sich mit eigenen Ausstellungen in ihren Häusern zu dem Thema präsentieren. Die AMS der VEM eröffnet ihre Sonderausstellung „Erst die Arbeit, dann die Mission“ am Sonntag, den 27. Oktober 2019.
Die Standbesucher konnten sich körperlich aktiv an der Tischtennisplatte der VEM betätigen und geistig herausfordern. Sprachkarten der Mitgliedskirchen der VEM führten zu engagierten Diskussionen, um welche Sprache es sich jeweils handeln könnte.
Stimmen starker Frauen – 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda
Am 24. Mai öffnete die Sonderausstellung „Stimmen starker Frauen – 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda“ im Wuppertaler Museum auf der Hardt.
Die Verarbeitung des Völkermordes in Ruanda 1994 war für das Projekt „Frauen in der Mission“ – eine Kooperation der Archiv- und Museumsstiftung der VEM und des Frauenreferates der VEM – eine besonders herausfordernde Aufgabe. Grundlage für die Ausstellung sei ein sechstägiger Workshop im März in Kigali gewesen, sagte Irene Girsang, verantwortlich für interregionale Frauenprogramme bei der VEM. Während dieser Begegnung lernten sich 17 Frauen, die den Genozid selbst miterlebten, näher kennen. Sie fassten schließlich den Mut, ihre Geschichten zu erzählen.
Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM und die VEM nahmen die Herausforderung an, über diese Thematik zu sprechen und Zukunftsperspektiven aufzuzeigen.
Im Rahmen einer Sonderausstellung veröffentlicht nun das Wuppertaler Museum auf der Hardt deren individuellen Erlebnisse. Die Geschichten der Frauen ermöglichen es, sich dem historischen Erbe der VEM und ihrer Partnerkirchen zu stellen, betonte Julia Besten, die Leiterin der Archiv- und Museumsstiftung der VEM. Sie schaffen Möglichkeiten für eine Versöhnung in der Gegenwart und sorgen für eine positive Entwicklung in der Zukunft.
Für die Begrüßung fand Volker Dally, Generalsekretär der VEM, die passenden Worte. Er dankte den rund 60 Gästen dafür, sich mit dieser sowohl schwierigen als auch schwerwiegenden Thematik zu beschäftigen. Einzig das Gespräch miteinander, so Dally weiter, ermöglichen Versöhnung, Veränderung und Frieden. Für ein solches Gespräch braucht es erhobene Stimmen – vor allem Stimmen derer, die die unvorstellbaren Grausamkeiten des Krieges und Völkermordes selbst miterlebten und bereit sind, über ihre Geschichten zu reden.
Eine Expertenrunde mit Mathilde Umuraza, VEM-Promotionsstipendiatin, John Wesley Kabango, Leiter der Abteilung Afrika der VEM, und Jochen Motte, stellvertretender Generalsekretär der VEM, diskutierte über den Genozid, dessen Hintergründe und Folgen. Uli Baege, verantwortlich für Projekte bei der VEM, und Christoph Schwab, Kurator der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, moderierten die Expertenrunde zur Situation in Ruanda vor, während und nach 1994. Die Diskussionsrunde betonte, wie wichtig Aufklärung, Versöhnung und Dialog in Ruanda seien und nahm dabei auch die VEM und ihre Partnerkirchen in die Pflicht weiter einen Beitrag dafür zu leisten. Das sei die Basis für eine friedliche Zukunft und soziale Gerechtigkeit in Ruanda. „Schließlich tragen die Kirchen eine gesellschaftliche Verantwortung. Wir sind nicht nur politische, wirtschaftliche, und zivile Organisationen, sondern auch christliche Organisationen. Wir sollten Grenzen überwinden und Raum schaffen, um die Verantwortlichen herauszufordern aktiv zu handeln“, resümierte die Ruanderin Mathilde Umuraza.
„Was nur geredet wird, wird schnell vergessen – was gesehen wird, behält der Mensch ganz lange“, sagte VEM-Generalsekretär Dally. Mit diesen Worten brachte er den Sinn der Sonderausstellung auf den Punkt: Die Geschichten der Frauen auf den in der Sonderausstellung gezeigten Silhouetten sind Ergebnisse des Redens – nicht des Schweigens über den Völkermord vor 25 Jahren. Sie geben die Stimme der starken Frauen wider, die unerlässlich sind und einen großen Beitrag für den Rahmen leisten, in dem Veränderung und Frieden wachsen können. Getreu des Leitsatzes der Archiv- und Museumsstiftung: „Geschichte für die Gegenwart“ bietet das Museum auf der Hardt der – durch verschiedene mit Bezug auf Ruanda ausgestellten Exponaten erweiterten – Sonderausstellung einen würdigen und geschützten Ort.
Die Sonderausstellung läuft bis zum 1. September 2019 (Missionsstraße 9, Wuppertal).
Christian Froese
Archiv- und Museumsstiftung der VEM

Ausstellungeröffnung mit Expertenrunde – 25 Jahre nach dem Völkermord in Ruanda Archiv- und Museumsstiftung der VEM und VEM laden ein

29.03.2019
Petra Dittmar, Leiterin des LVR-Freilichtmuseums Lindlar, lud gestern zusammen mit den Kooperationspartnern aus elf Bergischen Museen zu Pressetermin auf das Gelände in Lindlar ein. Unter dem Titel "Ganz viel Arbeit" informierten die Vertreter der sehr unterschiedlichen Museen über ihr gemeinsames Ausstellungsprojekt.
Die Museen aus der Region werden sich mit Sonderausstellungen, Symposien, Vorträgen, Lesungen, und Musikveranstaltungenin ihren Häusern dem Thema Arbeit in seiner Vielschichtigkeit und jeweils angelehnt an die eigenen Bestände und Vermittlungsinhalte widmen. Den Auftakt zu diesem facettenreichen Veranstaltuungsparcours übernimmt das Werkzeugmuseum in Remscheid. Darauf werden in etwa monatlichen Abständen die weiteren Kooperationspartner mit ihren jeweiligen Sonderschauen folgen.
Das Museum auf der Hardt eröffnet seine Sonderausstellung Ende Oktober, wenn der Zeittunnel im benachbarten Wülfrath seine Schau über die Arbeit der Kalker im ehemaligen Kalksteinbruch witterungsbedingt wieder schließen muss. Auf der Hardt können Besucher und Besucherinnen in der Ausstellung "Erst die Arbeit, dann die Mission. Der Alltag von Missionaren und Missionsschwestern in Afrika und Asien." erhellende Einblicke in eine ganz andere Arbeitswelt nehmen. Anhand von ausgesuchten Exponaten wie beispielsweise einer Nähmaschine von einer Missionsstation in Namibia werden auch die Arbeitsfelder von Missionsschwestern und Missionaren jenseits ihrer Hauptaufgabe, der Verbreitung des Christentums, thematisiert. Und nicht zuletzt wird, wie wie in vielen anderen Häusern auch, der teils tiefgreifende Wandel auf diesen Arbeitsfeldern von ihren Anfängen vor nahezu 200 Jahren bis in die Gegenwart aufgezeigt.
Beendet wir das Themenjahr schließlich im Mai 2020 mit der Bedeutung der Pause für die "ganze Arbeit" im Bergischen Museum für Bergbau, Handwerk und Gewerbe in Bensberg/Bergisch Gladbach.
Gefördert wird das Themenjahr "Ganz viel Arbeit" durch den Landschaftsverband Rheinland sowie über das Förderprogramm Regionale Kulturpolitik des Landes NRW.
Eine gemeinsame Werbeplattform im Internet befindet sich aktuell im Aufbau. Termine und weitere Informationen werden noch vor Beginn der Veranstaltungen dort bereitgestellt.
Gerd Hankel verfolgt seit vielen Jahren die Entwicklung Ruandas. Er beschreibt, wie das Land wahrgenommen werden will - und wie es ist. Er ist Autor zahlreicher Beiträge zum humanitären Völkerrecht, zum Völkerstrafrecht und zum Völkermord in Ruanda, dessen juristische Aufarbeitung er seit 2002 untersucht.
Lesung im Museum auf der Hardt - Missionsstraße 9 - 42285 Wuppertal
Uhrzeit: 19.00 Uhr
Eintritt frei - Spenden erbeten
Wir erbitten Ihre Anmeldung bis Mittwoch, den 6. Februar 2019, an ams[at]vemission.org
»Bamba, der Neffe des Zauberers« – Ein Stummfilm der Mission mit Livemusik
von Brunhild von Local/VEM
»Prosit Neujahr«, mit diesem Trinkspruch für 2019 begrüßte Julia Besten rund 40 Gäste am Sonntagmorgen zum Neujahrskonzert der Stiftung. Dabei betonte die Leiterin der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, dass es kein Konzert im klassischen Sinne sei, vielmehr ein audio-visueller Neujahrsblick auf den Stummfilm »Bamba, der Neffe des Zauberers«aus dem Jahr 1939, der Arbeit und das Wirken der Mission im ehemaligen Belgisch-Kongo zeigt. Klavier, Trompete, Schlagzeug und Sopran begleiten den Film musikalisch, sozusagen als Uraufführung, so Besten. Die Filmmusik hat Benjamin Pfordt, Student der Musikhochschule Münster und ehemaliger Nord-Süd-Freiwilliger der VEM, geschrieben.
»Mich hat das Originalfilmplakat fasziniert«, sagte Volker Martin Dally, der Vorstandsvorsitzende der Archiv- und Museumsstiftung der VEM und Generalsekretär der VEM. Der Reinerlös sei damals bestimmt gewesen für die Rheinische Missionsgesellschaft in Wuppertal-Barmen. Schon damals haben also die Verantwortlichen gewusst, wie man mit schönen Veranstaltungen Fundraising machen kann.
Christoph Schwab, der Kurator der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, erklärte dem Publikum, warum Filme wie Bamba gedreht wurden. Missionsfilme seien in erster Linie Werbefilme gewesen. Zum einen, um über die Arbeit der Missionsgesellschaften zu informieren, zum anderen, um Spenden einzuwerben. Interessant bei diesem Film sei vor allem ein Aspekt von Missionsarbeit, der sogenannte Missionsärztliche Dienst. Ein Thema, das in vielen Gesellschaften, nicht nur in Zentralafrika, auch heute noch aktuell sei, sei der Gegensatz zwischen »traditioneller Heilung«, aber auch dessen Kehrseite der Ächtung bis hin zur Tötung jener, die der Hexerei verdächtigt werden, und der sogenannten westlichen Schulmedizin. In dem Film werde ein ganz grundlegendes soziologisches Thema verhandelt, das Geschichte, Gegenwart, aber auch die Identität und das Selbstverständnis des Menschen ganz wesentlich bestimme. »Das Phänomen gesellschaftlicher Umbrüche, die das soziale Gefüge und die Beziehungen der Menschen untereinander in einer Gemeinschaft tiefgreifend verändern, das trifft auf die beiden Protagonisten des Films – Bamba und seinen Onkel – in ganz besonderer Weise zu.«
Der 40minütige Film ist rasch erzählt: Er zeigt die Geschichte des kleinen Jungen Bamba, der zu der ethnischen Gruppe der Bakongo gehört. Er wohnt bei seinem Onkel. So will es die Tradition. Der Onkel ist der traditionelle Heiler eines Dorfes im Mündungsgebiet des Flusses Kongo. Der Film handelt von der Bekehrung des kleinen Bamba zum Christentum und davon, wie sich schließlich das ganze Dorf einschließlich seines Onkels zum Christentum bekennt.
Das Publikum im Museum fühlt sich in die Stummfilmzeit versetzt. Mit dem kleinen Unterschied, dass die bewegten Bilder nicht vom Projektor gezeigt, sondern vom Laptop abgespielt werden. Wirklich stumm waren die Filme seinerzeit ja nicht. Es war üblich, Musik hinzuzufügen, um beispielsweise das lästige Rauschen des Projektors zu überspielen und den Darstellern auf der Leinwand Leben einzuhauchen. Meist haben Klavier- oder Orgelspieler die Bilder musikalisch emotionalisiert, weil sie improvisierend am besten der schnellen Abfolge der Bilder folgen konnten. Diesen Part haben diesmal Benjamin Pfordt und das kleine, aber feine Ensemble übernommen.
Viel Zeit und Leidenschaft hat Benjamin Pfordt darin investiert, die Musik für diesen längst vergessenen Film zu schreiben. Herausgekommen ist ein »Filmkonzert«, ein Ohren- und Augenschmaus. Pfordt und das Ensemble – alle vier studieren an der Musikhochschule Münster – haben eine Verbindung von zeitgenössischer Musik und Dokumentarstummfilm geschaffen.
Gänsehaut pur gleich zu Beginn mit einem kurzen Trompetensolo der mehrfach ausgezeichneten Preisträgerin bei »Jugend musiziert«: Annabell Bialas spielt die Trompete im vierköpfigen Ensemble. Auch die Stimme von Amanda Kyrie Ellison löst Gänsehaut aus. Etwa wenn sie das Vaterunser auf Kikongo singt, einer im Westkongo verbreiteten Bantusprache. Auch bei dem eigens komponierten Lied »O zola«, das auf dem Hohelied der Liebe basiert, stellt sich ein wohliger Schauer ein. Ein-, zweimal kommentiert die Masterstudentin des Operngesangs überraschend in der Art einer Moritatensängerin das bewegte Bild. Das Schlagzeug von Bennet Fuchs gibt den Takt vor und lässt das kongolesische Dorf lebendig werden. Fuchs beherrscht das Schlagzeug von Jazz bis Rock. 40 Minuten spielen sie ohne Pause. Die Musik ist bildsynchron. Eine Aufgabe, die höchste Konzentration erfordert. Mit Musik kann man viel erzählen. Das haben die vier Musiker an diesem Sonntagmorgen bewiesen. Alle vier haben eine Atmosphäre erzeugt, die Film und Musik verbindet und damit ein neues Gesamtkunstwerk für Augen und Ohren geschaffen. Das begeisterte Publikum dankte es ihnen mit anhaltendem Applaus.
Freuen Sie sich auf ein Neujahrskonzert der besonderen Art.
Der Stummfilm aus dem Jahr 1938 zeigt die Arbeit und das Wirken der Mission im Kongo. Benjamin Pfordt, Musikstudent der Universität Münster, hat eigens eine Filmmusik kompnoiert und wird live spielen.
Mit einem Glas Sekt stoßen wir gemeinsam an.
Zeit: Sonntag, 13. Januar 2019, 11.00 Uhr
Ort: Museum auf der Hardt, Missionsstraße 9, 42285 Wuppertal
Eintritt: 15 Euro
Um verbindliche Anmeldung wird gebeten bis zum 9. Januar 2019. Anmeldungen unter: Tel: 0202-89004-841 oder per Mail: ams@vemission.org

Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM eröffnete die von ihr konzipierte Ausstellung "Rheinisch in die Welt" gemeinsam mit Präses Rekowski auf der Landessynode der EKiR

Die AMS der VEM besucht Halle, Leipzig und Dresden
Erste Station der zweitägigen Informationsreise der kleinen Reisegruppe – Mitarbeiter der Archiv- und Museumsstiftung der VEM gemeinsam mit ihrem Vorstand – waren die Franckeschen Stiftungen in Halle. Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen der Reisegruppe und dem Direktor der Franckeschen Stiftungen Thomas Müller-Bahlke sowie weiteren Vertretern, stand unter anderem der Austausch und die Arbeitsweise in Archiv und Museum. Auch der Besuch des Archivs des Leipziger Missionswerkes, das als Depositum im Archiv der Franckeschen Stiftungen liegt, stand auf dem Programm. Während der Gespräche wurde über mögliche künftige gemeinsame Projekte gesprochen.
Auf ihrer zweiten Station, in Leipzig, wurde das Museum des Leipziger Missionswerkes, das insbesondere Jugend- und Konfirmandengruppen, aber auch von Partnerschaftsgruppen aus den Partnerländern des Missionswerkes genutzt wird, besucht.
Am zweiten Tag der Reise ging es nach Dresden. Das Deutsche Hygiene-Museum Dresden zeigt seit Mai dieses Jahres die Ausstellung Rassismus – Die Erfindung der Menschenrassen, die noch bis zum 6. Januar 2019 zu sehen ist. Die Archiv- und Museumsstiftung der VEM hat zu diesem Zwecke einige Objekte aus ihrem Bestand an das Museum in Dresden ausgeliehen. In Gesprächen mit Mitarbeiterinnen des Museums wurden Ausstellungsaufbau, Nutzung der Ausstellung durch Schulen für den Unterricht und die Auseinandersetzung mit der hauseigenen Geschichte diskutiert. 90 000 Besucher haben auch die ausgeliehenen Objekte der Archiv- und Museumsstiftung der VEM im Kontext der Ausstellung bis jetzt gesehen.
Foto: In der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen. Der Archivar, Jürgen Gröschl erklärt den Wiederaufbau der Bibliothek. Von links: Jürgen Gröschl, Wolfgang Apelt, Leiter Archiv und Bibliothek der AMS der VEM, Timo Pauler, Geschäftsführer der VEM und stellv. Vorsitzender der AMS der VEM, Christoph Schwab, Kurator der AMS der VEM, vorne: Volker Martin Dally, Generalsekretär der VEM und Vorstandsvorsitzender der AMS der VEM
Katholische Studierenden- und Hochschulgemeinde Münster und Evangelische Studierendengemeinde Münster laden ein:
Podiumsdiskussion mit Vertretern verschiedener christlicher Konfessionen (29.11.2018, 20.00 Uhr, Cafe Milagro, Münster) und Dokumentarstummfilm mit musikalischer Untermalung (04.12.2018, 20.00 Uhr, Cafe Weltbühne, Münster) in Kooperation mit der Archiv- und Museumsstiftung der VEM und der VEM
„Eine Mission kommt in die Jahre“ – 200 Jahre Barmer Missionsgesellschaft
Unter diesem Motto präsentieren sich Archiv- und Museumsstiftung der VEM und Vereinte Evangelische Mission ab 11.00 Uhr mit einem Stand auf dem Elisenturmfest auf der Hardt. Erfahren Sie Interessantes aus der Missionsgeschichte, probieren Sie, alte Handschriften der Missionare zu lesen und schreiben Sie Ihren Namen in Sütterlin.
Bewegen Sie sich an der kleinsten Tischtennisplatte und lernen Sie die Arbeit der VEM kennen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
"Zu Gast bei...", - Kooperationsprojekt mit dem Niederbergischen Museum Wülfrath. Unter diesem Motto stellen sich beide Museen im jeweils anderen mit kleinen Ausstellungen und verschiedenen Veranstaltungen vor. Vom 12. April bis zum 1. Juli haben Sie die Möglichkeit, die Gemeinsamkeiten beider Museen kennenzulernen.
Details zu unserem Kooperationspartner finden Sie hier:
Am 01.07.2018 findet von 15:00 bis ca. 17:00 Uhr eine Bergische Kaffeetafel mit Lesung im Museum auf der Hardt statt.
Es werden unterhaltsame und heitere Anekdoten rund um die Bergische Kaffeetafel und Erlebnisse aus der Arbeit der Mission seit ihrer Gründung im Jahr 1828 vorgetragen.
Diese Veranstaltung findet im Rahmen des großangelegten Kooperationsprojektes „Zu Gast bei…“ statt und ist zugleich die Abschlussveranstaltung des dreimonatigen Projektes.
Für diese Lesung in Verbindung mit einer ‚Bergischen Kaffeetafel‘ in Buffetform wird ein Betrag von EUR 15.- erhoben.
Anmeldungen bis zum 27.06.18 unter 02058/7826690.
Im Rahmen des Kooperationsprojektes „zu Gast bei…“ im Niederbergischen Museum Wülfrath, Bergstr. 22, 42489 Wülfrath
Am 17.06.2018 findet von 14:00 bis ca. 16:00 Uhr (die Fußball Fans brauchen keine Angst zu haben, etwas vom Spiel der deutschen Mannschaft gegen Mexiko zu verpassen) eine Bergische Kaffeetafel mit einer Lesung aus den Archiven der Mission statt. Es werden unterhaltsame und heitere Anekdoten und Erlebnisse aus der Arbeit der Mission in Wuppertal seit ihrer Gründung im Jahr 1828 vorgetragen.
Für diese Lesung in Verbindung mit einer ‚Bergischen Kaffeetafel‘ wird ein Betrag von EUR 15.- erhoben.
Um Anmeldungen bis zum 13.06.18 unter 02058/7826690 wird gebeten.
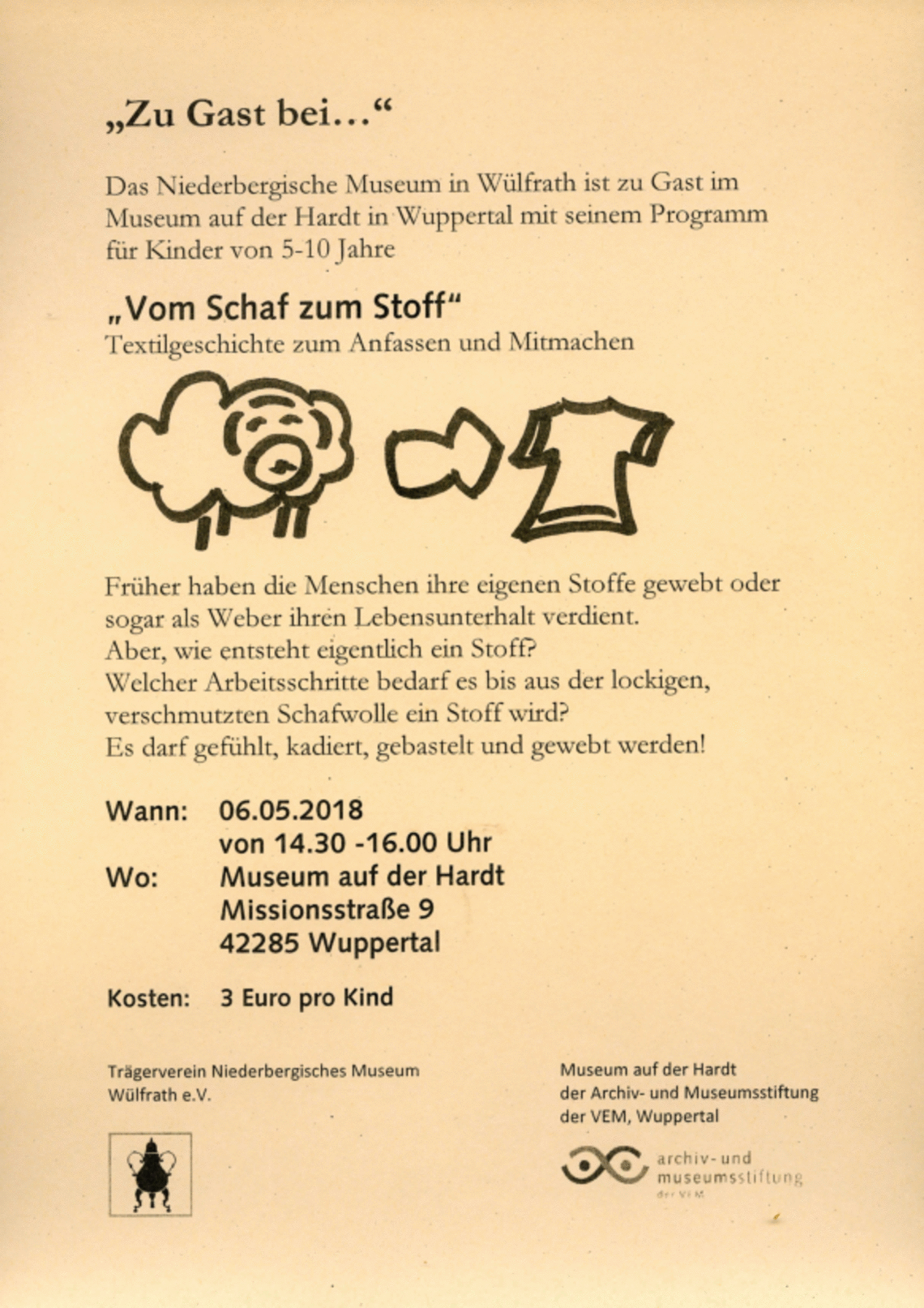


Die rund 30 Gäste des Abends waren alle überrascht, wie schnell 70 Minuten vergehen können. Das lag wohl insbesondere an Thomas Gerhold, dem Kantor der Evangelisch-Reformierten Kirche in Wülfrath, der den Stummfilm „In Jesu Dienst von Bethel nach Ostafrika“ aus dem Jahr 1928 musikalisch begleitete. „Musik zu bewegten Bildern zu machen, hat mich total gereizt“ sagt Gerhold.
Im Rahmen des Kooperationsprojektes „Zu Gast bei…“ hatte die Archiv-und Museumsstiftung der VEM den Film aus ihrem Archiv nach Wülfrath gebracht. Das Niederbergische Museum bot mit seinem Filmraum einen idealen Rahmen. Christoph Schwab, Kurator des Museums auf der Hardt in Wuppertal sagte schon vor Beginn: „Es wird Filmmusik sein, die in diesem Ambiente sehr schön widerspiegelt, wie ein solcher Film ausgesehen haben könnte“. Reisten doch die Missionare mit den Filmen durch das bergische Land, um Werbung für die Missionsarbeit zu machen.
Ergänzt wurde der Film außerdem mit Originalbegleittexten, das Publikum folgte gebannt dem Wiederaufbau der Rheinischen Missionsarbeit in Tansania Ende der 1920er Jahre und war sich einig: es soll nicht der letzte Stummfilmabend gewesen sein.
Besonderer Filmabend im Rahmen des Kooperationsprojektes der Archiv- und Museumsstiftung der VEM und des Niederbergischen Museums Wülfrath am Freitag, 27. April 2018, 19 Uhr im Niederbergischen Museum Wülfrath, Bergstraße 22, 42489 Wülfrath.
Das Niederbergische Museum Wülfrath und die Archiv- und Museumsstiftung der VEM in Wuppertal laden ein zu einem Filmabend der besonderen Art. „In Jesu Dienst von Bethel nach Ostafrika“, so heißt der Stummfilm aus dem Jahr 1928.
Ort der Veranstaltung ist das Niederbergische Museum in der Bergstraße 22 in Wülfrath.
Der Stummfilm, der den Weg der Missionare der Bethel Mission und ihre Arbeit in Tansania zeigt, wird musikalisch begleitet vom Wülfrather Kantor Thomas Gerhold. Wolfgang Apelt und Christoph Schwab von der Archiv- und Museumsstiftung der VEM aus Wuppertal werden zeitgenössische Texte lesen.
Der Stummfilm „In Jesu Dienst von Bethel nach Ostafrika“ wurde nach der Wiederaufnahme der Arbeit der Bethel Mission in der Region Usambara, Tansania, erstellt. Der gut 60minütige Film wurde als Werbemittel für die Menschen in der Heimat eingesetzt.
Während der Laufzeit des Kooperationsprojekts (12. April bis 1. Juli 2018) präsentieren sich beide Museen auch in den Ausstellungsräumen des jeweils anderen Hauses. Das weitere Rahmenprogramm finden sie hier:
www.vemission.org/museumarchive
www.niederbergisches-museum.de
„Wir möchten viele Menschen für beide Museen begeistern“. So brachte Karin Fritsche, Geschäftsführerin des Niederbergischen Museums Wülfrath, die Projektidee auf den Punkt. Das Kooperationsprojekt „Zu Gast bei …“ wurde offiziell am 12. April 2018 in der Stadt Wülfrath eröffnet. Die Idee, die dahinter steckt: Das Niederbergische Museum Wülfrath und das Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM präsentieren sich jeweils im anderen Haus. Schon bei der Vorbereitung entdeckten die beiden Museen zahlreiche Verbindungen und Gemeinsamkeiten. In einem bunten Programm können die Museumsgäste bis zum 1. Juli 2018 nun Neues aus der Region kennenlernen.
Das Niederbergische Museum Wülfrath bietet neben der Bergischen Kaffeetafel auch Konzerte, Lesungen und Sonderausstellungen. „Eine Leistung, die nur mit den rund 50 Ehrenamtlern möglich ist“, so Fritsche.
„Sinn der Kooperation ist, das kulturelle Umfeld noch besser kennenzulernen und neugierig zu machen auf das, was über die Stadtgrenze hinaus in der Nachbarschaft geschieht“, sagt Christoph Schwab, Kurator des Museums auf der Hardt in seiner Ansprache für den Kooperationspartner aus Wuppertal.
André Enthöfer, Wuppertaler Musiker und eng verbunden mit der Archiv- und Museumsstiftung der VEM, hatten die Wuppertaler „mitgebracht“. Seine Klarinetten-Improvisationen begeisterten das Publikum. Bei dem Stück „Lobe den Herrn“ stimmte das Publikum mit leisem Gesang ein.
Christa Hoffmann vom Niederbergischen Museum machte neugierig auf das, was im Museum auf der Hardt in Wuppertal zu sehen sein wird. „Wir haben eine Stube aufgebaut. Sie hat einen Kamin, sogar Waffeln finden Sie auf dem gedeckten Tisch“. Die Schale, die die Kaffeetropfen der Dröppelminna auffängt, sei ursprünglich für Schnaps vorgesehen. Es bleibt spannend, was die Besucherinnen und Besucher bei den kommenden Veranstaltungen in beiden Häusern erwarten wird.
Julia Besten, Archiv- und Museumsstiftung der VEM
Wie man ein Publikum in wenigen Minuten von Null auf Hundert bringt, hat an diesem Abend Singer und Songwriter Ees im Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM vorgemacht. Vor knapp hundert Leuten hat Namibias Jugendidol bei seinem Auftritt im Rahmen des Länderseminars Namibia & Botsuana der VEM die Museums-Bühne gerockt. Im farbenfrohen T-Shirt im Sun African Style, schwarzem Hut und Sneakers im Zebralook präsentiert der 34-Jährige zusammen mit seiner Gitarrenbegleitung Lars seinen ganz eigenen „NAM Flava“-Stil. Nam Flava, so bezeichnet Ees selber seine Musik-Richtung, eine Mischung aus Kwaito, African House, Afro Pop, Reggae und Hip-Hop. Kwaito ist eine Musikart, die in Südafrika entstanden ist, damals eine Antiapartheidmusik, heute eine flotte Tanzmusik, die Ees den Menschen in Deutschland näherbringen möchte. Ein bisschen mehr Sonne in die kalte Winterzeit bringen. In Namibia ist Ees, der eigentlich Eric Sell heißt, als einziger Weißer ein Star des Kwaito, der von einer treuen Fan-Gemeinde begleitet wird.
Der studierte Tontechniker mit deutscher Abstammung in fünfter Generation pendelt seit ein paar Jahren zwischen Windhuk und Köln und möchte seine positiven Lieder nach Deutschland, nach Europa bringen. Ees singt auf Englisch, auch finden Nam-Slang-Worte in seine Texte. Ein Mix aus Deutsch, Englisch und Afrikaans. Seine Songs drehen sich um Liebe und Sehnsucht, ums Erwachsenwerden der Jugendlichen im südlichen Afrika, um Hoffnung und Glück, auch wenn das Leben in Namibia so manch einem nicht viel zu bieten hat. Seine Texte sind das pralle Leben. Seine Fröhlichkeit ist ansteckend und seine gute Laune allgegenwärtig, in den Texten, den Melodien. Schon beim ersten Song „Woza December“ (Komm her, Dezember) sind die Zuschauer in Stimmung. „Musik ist da, um Menschen zu bewegen“, sagt Ees. Etwa mit dem nachdenklichen Song „Just do it!“, der die Leute auffordert, an den Start zu gehen, „auch wenn du mal wieder nicht weißt, was du willst oder wer genau du bist, geh hin, mach genau was du fühlst, steh auf!“
Ees weiß, wie man unterhält und das Publikum in seinen Bann zieht. Er flirtet mit dem Publikum, neckt seinen Gitarrenspieler, tanzt auf der Bühne. Bei dem Song „We are one“ gibt Ees die Regieanweisung ans Publikum, nicht zu klatschen, lieber zu singen „We got different faces but we are all the same. It’s our future! Let’s live our life!“ (Wir haben zwar unterschiedliche Hautfarben, aber wir sind alle gleich. Es ist unsere Zukunft! Lass uns unser Leben leben!). Die Energie, der Spaß, den Sänger Ees und seine Begleitung auf der Gitarre am gemeinsamen Musizieren haben, überträgt sich rasch auf die Zuhörer. Eineinhalb Stunden starke Präsenz auf der Museums-Bühne. Mit der Zugabe Again `n Again bescherte Ees dem Publikum einen bewegenden Abschluss. Und das Publikum belohnte das unplugged Konzert an außergewöhnlichem Ort mit minutenlangem lautstarken Applaus und spontanen Tanzeinlagen. Am Ende hielt es niemand mehr auf den Stühlen im Ausstellungsraum. Bei dieser energiegeladenen Musik musste man sich ganz einfach bewegen, tanzen, mitsingen.
Auch nach dem Konzert nimmt sich Ees Zeit für seine Fans, die zum Teil weit angereist sind. Ein Star zum Anfassen. Das Konzert im Museum hat gezeigt, dass eine Veranstaltung an einem ungewöhnlichen Ort ein Weg sein kann, neue interessierte Menschen – vor allem junge Menschen – zu begeistern.
Pfarrer Joachim Dührkoop vom Gemeindedienst für Mission und Ökumene (GMÖ) eröffnete am Samstag das Länderseminar Namibia & Botsuana. Ees erzählte an diesem Morgen aus erster Hand über seine Jugend im südlichen Afrika. Eingeladen hatte die Vereinte Evangelische Mission und die Archiv- und Museumsstiftung der VEM. Rund 50 interessierte Gäste waren der Einladung nach Wuppertal gefolgt. Auch hier nimmt sich Ees Zeit für seine alten und neuen Fans, und erzählt ausführlich über seine Kindheit und Jugend in Namibia. Und darüber, wie stolz er heute sei, ein Namibier zu sein. Seine Sneakers sind mit der namibischen Flagge bedruckt. Als er 1983 in Windhuk zur Welt kommt, war Namibia noch der kleine Bruder Südafrikas und Ees, alias Eric Sell, ein kleiner Namboy, der „Wellblechdeutsch“ sprach. 1990 wurde Namibia unabhängig und Ees eingeschult. Zum ersten Mal durften „schwarze“, „weiße“ und „coloured“ Kinder gemeinsam zur Schule gehen. Für ihn sei das damals normal gewesen.
Sein Interesse für Musik, für Kwaito wurde während der Schulzeit geweckt. „Ich habe zwar kein Wort verstanden, aber die Musik war klasse.“ Das Wort Kwaito setzt sich zusammen aus „Kwai“ ist afrikaans und heißt total angesagt, „to“ steht für Township – also das Angesagte aus dem Township: einfach nur laut sein, pfeifen, tanzen. Seit 2004 macht Ees Kwaito-Musik. Die Meinung der Kritiker ist anfangs geteilt: Darf ein weißer Afrikaner Kwaito machen? Schwarze Namibier fühlten sich getäuscht und meinten, dass er ein Schauspieler sei. Heute wissen diese Kritiker, dass auch ein weißer Namibier Kwaito genauso gut spielen kann wie ein Schwarzafrikaner.
„Über Musik lässt sich eine neue Identität Namibias vermitteln“, davon ist Ees überzeugt. Die fortschreitende Digitalisierung habe in den vergangenen Jahren auch die Musikbranche in Namibia extrem verändert. Vor 20 Jahren gab es dort praktisch keine Musikindustrie, sagt Ees. Heute haben 99 Prozent der Jugendlichen in Namibia ein Smartphone, vernetzen sich über Facebook oder andere Plattformen mit der ganzen Welt. Die sozialen Netzwerke sind aus dem Leben der meisten Jugendlichen in Namibia nicht mehr wegzudenken. Wie einflussreich die sozialen Netzwerke sind zeigt der Aufruf von Ees Anfang März: Unter dem Motto „#itsup2us“ hatte Ees mit einer Videobotschaft alle Namibierinnen und Namibier aufgerufen, am 21. März, dem Unabhängigkeitstag, die Initiative zu ergreifen und etwas für eine saubere und grünere Umwelt zu tun: zum Beispiel Müll aufsammeln oder Bäume pflanzen und sich für sozial Schwache einzusetzen. Hundertausendfach wurde der Aufruf geteilt. Die Reaktionen in Namibia waren unterschiedlich. Viele der älteren Generation hätten seinen Aufruf negativ bewertet. Ees habe quasi als Weißer versucht, den Namibiern zu sagen, wie sie ihren Unabhängigkeitstag feiern sollen. Ein Weißer, der vom System Apartheid profitiert habe, so die Argumentation. Finanzminister Schlettwein habe getweetet, dass jeder seinen eigenen Dreck täglich wegmachen, und dass der Unabhängigkeitstag nicht durch einen Säuberungstag ersetzt werden solle. Präsident Geingob meinte, dass das schon lange seine Idee gewesen sei und rief die Menschen auf, am 1. Mai etwas für das Land zu tun. Doch 90 Prozent der Jugendlichen – schwarze wie weiße – fanden die Aktion „cool“. Die Jugendlichen in Okahandja beispielsweise hätten sich gleich nach dem Aufruf dazu entschlossen, ihre Stadt „sauber zu machen“. Ein Beispiel, wie soziale Medien Menschen motivieren, vor allem junge Menschen, sich für ein sauberes Umfeld zu engagieren. In Afrika leben prozentual gesehen so viele junge Menschen wie nirgendwo sonst in der Welt.
Ein interessantes Seminarthema, wo der ein oder andere Seminarteilnehmer sicher etwas für sich mitnehmen konnte und inspiriert wurde im Blick auf die Arbeit mit den Kirchen und Gemeinden in Namibia.
Brunhild von Local (Foto: VEM)
Im Rahmen des VEM-Länderseminars Namibia & Botsuana konzertiert und spricht Ees über die Jugendkultur im südlichen Afrika
Afrikanische Rhythmen zwischen Kwaito, African House, Afro Pop und Hip Hop werden am Freitag, 16. März, 19 Uhr, das Museum auf der Hardt in einen Konzertsaal verwandeln. An diesem Abend wird Ees im Museum auf der Hardt seinen ganz eigenen Stil präsentieren. „NAM Flava“ bezeichnet er selber seine Musik-Mischung aus dem südafrikanischen Kwaito, African House, Afro Pop und Hip Hop. In seiner Heimat Namibia ist Ees bereits ein Superstar. Er beschäftigt sich in seiner Musik mit der Kultur der Jugendlichen im südlichen Afrika. Wie leben, fühlen und denken die jungen Menschen?
Der 34-jährige Namibier mit deutscher Abstammung hat sich auch international bereits einen Namen gemacht. So schrieb, produzierte und sang Ees beispielsweise in Deutschland den offiziellen Song der Fußballweltmeisterschaft 2010 von Bild Online. Für den Radiosender WDR 2 hat er den Song „Get your hands up“ komponiert und gesungen. Ees hat bislang 13 Alben veröffentlicht und wurde für seine Musik mit wichtigen Preisen ausgezeichnet, wie den MTV Africa Music Awards, den Namibia Music Awards und den afrikanischen Grammy KORA Awards für das beste Album. Im Rahmen eines unplugged Konzertes wird Ees seine Arbeit vorstellen und praktische Einblicke in die Jugendkultur Namibias geben. Am darauf folgenden Tag wird er im Rahmen einer Diskussionsrunde aus erster Hand über Jugendkultur im südlichen Afrika berichten.
Das Länderseminar beginnt mit dem Konzert am Freitag, 16. März 2018, 19 Uhr, Missionsstraße 9, Wuppertal. Eine Anmeldung ist erforderlich bis zum 6. März ams@vemission.org– Tickets für das Konzert kosten 18 Euro pro Person, inklusive eines Freigetränks. Das Länderseminar endet Samstag, 17. März, 15 Uhr.
Hörprobe auf youTube: EES – "On the road again"
https://www.youtube.com/watch?v=toKfvXkZ3zo
Hörprobe auf youTube: EES – "Again 'n again"
https://www.youtube.com/watch?v=3vJQrsQl20c&lc=z12ntxdbixjqtntku223wdpoxx20fxstj
"Wir holen uns die Länder direkt ins Haus und möchten einen Gruß im Geiste von Hoffnung, Freundschaft und Frieden übermitteln," mit diesen Worten begrüßte Julia Besten, Geschäftsführerin der Archiv- und Museumsstiftung der VEM (AMS), die zahlreichen Gäste des erstmals veranstalteten Neujahrskonzerts am 21. Januar im Museum auf der Hardt in Wuppertal. Letztere freuten sich über eine kurzweilige Performance des neunköpfigen deutsch-indonesischen Ensembles unter der Leitung des Berufsmusikers Ropudani Simanjuntak. Das traditionelle indonesische Angklung-Spiel wurde begleitet von zeitgenössischen Instrumenten wie E-Piano, Bass- und E-Gitarre. Professionell vorgetragener Gesang und Tanz aus Bali verzauberten die Zuschauerinnen und Zuschauer über rund eine Stunde. Bei den Liedern handelte es sich mehrheitlich um Kirchen- und Segenslieder aus Bali und Java.
In seinem Grußwort verwies Pfarrer Volker Martin Dally, Vorstandsvorsitzender der Archiv- und Museumsstiftung und der Vereinten Evangelischen Mission, auf den hier feststellbaren positiven Synkretismus, da die Verschmelzung von indonesischen Kulturelementen mit der christlichen Religion neue volksreligiöse Kultformen hervorgebracht habe. Er schlussfolgerte, dass diese Indigenisierung des Glaubens, trotz großer Kritik einiger Missionare in der Vergangenheit, die christliche Religion in den damaligen Missionsfeldern letztlich gestärkt habe - das starke Wachstum der Kirchen in Afrika und Asien sei der Beweis. Die Aufgabe der Archiv- und Museumsstiftung bestehe darin, diesen Schatz zu bewahren, neu zu bewerten und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, beispielsweise in Form dieses Neujahrskonzerts.
Die Malerei von Nyoman Darsane ist noch bis zum 23. Februar 2018 im Museum auf der Hardt auf dem Heiligen Berg in Wuppertal zu sehen.
„Rassismus. Die Erfindung von Menschenrassen“ im Deutschen Hygiene-Museum Dresden, die bis Januar 2019 laufen wird. Eine Ausstellung, die bereits im Vorfeld zahlreiche Diskussionen angeregt hat.
Die Archiv- und Museumsstiftung ist Kooperationspartner und hat mehrere Schriftstücke, Karten und Objekte aus und über Namibia an das Museum ausgeliehen
Exklusives Konzert mit Musik und Tanz aus Bali im Rahmen der Ausstellung „Das Wort wird Tanz“
Mit einem exklusiven Konzert balinesischer Musik und Tanz beginnt die Archiv- und Museumsstiftung der VEM das Jahr 2018. Die Stiftung lädt ein zum Neujahrskonzert am Sonntag, 21. Januar 2018 um 11 Uhr in das Museum auf der Hardt (Missionsstraße 9, Wuppertal-Barmen). „Dies ist der erste Neujahrsempfang der Stiftung“, sagt Geschäftsführerin Julia Besten. Und sie verspricht ein buntes Programm mit balinesischer Musik, die den Vormittag auflockern wird. Ein indonesisches Musik-Ensemble mit Keyboard, E- und Bass-Gitarre, Trommel und Bambus-Flöte bringt traditionelle und zeitgenössische Klänge aus Bali. Zur Künstlergruppe unter der Leitung von Ropudani Simanjuntak gehören auch zwei Sänger und zwei Tänzer.
Volker Martin Dally, der Generalsekretär der Vereinten Evangelischen Mission, wird zum neuen Jahr eine kurze Ansprache halten. Anschließend kann die aktuelle Ausstellung „Das Wort wird Tanz“ des balinesischen Künstlers Nyoman Darsane besucht werden.
Der Neujahrsempfang ist eine gute Chance, einen Einblick in die Arbeit der Stiftung und des Museums zu erhalten.
Wir erbitten Ihre verbindliche Anmeldung wegen begrenzter Platzzahl bis Mittwoch, 17. Januar 2018 an ams[at]vemission.org. Eine Karte kostet 15 Euro.
Öffnungszeiten – Museum auf der Hardt für die Dauer der Ausstellung
Donnerstag, Freitag und Sonntag: 11-17 Uhr, Dienstag 13-16 Uhr und auf Anfrage
Ausstellung „Das Wort wird Tanz“ – Christliche Kunst aus Bali mit Bildern von Nyoman Darsane im Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM in Wuppertal eröffnet
„Kunst ist ein Mittel, um Gottes Gegenwart in der Welt darzustellen“, mit diesen Worten eröffnete Julia Besten die Ausstellung mit Bildern von Nyoman Darsane. Dieses Mittel habe auch der balinesische Künstler eingesetzt, um Gottes Gegenwart auf der hinduistisch geprägten Insel zu bezeugen, betonte die Geschäftsführerin der Archiv- und Museumsstiftung der VEM.
Als Mitglied des Stiftungsvorstands begrüßte Timo Pauler die knapp 60 Kunstinteressierten, die der Einladung gefolgt waren, darunter auch die Leiterin der Ökumene-Abteilung der rheinischen kirche, Barbara Rudolph, und den Stadtverordneten der Grünen, Peter Vorsteher, sowie Mitarbeitende aus afrikanischen und asiatischen Mitgliedskirchen der Vereinten Evangelischen Mission, die sich zurzeit zum Arbeitsaustausch in der Wuppertaler Zentrale treffen. Pauler teilte seine ganz persönlichen Gedanken über den Titel der Ausstellung „Das Wort wird Tanz“ mit. Er habe sich gefragt, warum man diesen Titel gewählt habe und nicht „Das Wort ward Fleisch“ – so wie es im Johannesevangelium stehe. Im Namen des Vorstands dankte er dem Stiftungsteam für die ausgezeichnete Vorbereitung der Ausstellungseröffnung.
Kurator Christoph Schwab stellte den Künstler Darsane und seine Malerei vor. „Die Malerei eines Mannes, der in ganz verschiedenen kulturellen Traditionen verwurzelt ist“, sagte er.
Nyoman Darsane wurde 1939 auf der indonesischen Insel Bali in eine hinduistische Familie hineingeboren. Aufgewachsen in dieser balinesisch-hinduistischen Tradition hat sich der heute 78jährige Künstler schon früh für das Christentum interessiert, das europäische Missionare im 19. Jahrhundert auf die Insel brachten. Mit 17 Jahren ließ er sich taufen. Studiert hat Darsane unter anderem an der Kunsthochschule der javanischen Hafenstadt Semarang, wo er neben der darstellenden Malerei auch Kunstpädagogik, klassische chinesische Maltechniken und Farbenlehre kennenlernte. Der Spross einer Musikerfamilie war bereits früh mit den traditionellen Künsten Balis vertraut. In seinen Bildern spiegeln sich die künstlerischen Ausdrucksformen der hinduistischen religiösen Tradition, denen sich viele Menschen in seiner Heimat als Hindus verbunden fühlen. Etwa die Formen und intensiven bunten Farben des traditionellen balinesischen Tanzes. „Religiöse Inhalte im Hinduismus drückt er durch den balinesischen Tanz aus.“ Aber auch christliche Elemente finden sich in seiner Malerei wider. „Spätestens seit Ende der 1970er Jahre ist die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Christentum ein zentrales Thema seiner Arbeiten“, sagte Christoph Schwab. „Darsane vermittelt zwischen zwei Polen: Seiner aus Überzeugung gewählten und auf Bali noch sehr jungen Religion auf der einen und den Menschen Balis, die in ihrer großen Mehrheit fest in den hinduistisch-balinesischen Traditionen verwurzelt sind“, so der Kurator der Museumsstiftung. Die farbenfrohe balinesische Kultur spiegelt sich in seiner Malerei ebenso wider wie verschiedene christliche Elemente. In Darsanes Bildern tanzen einem die Worte der Bibel regelrecht entgegen, so habe es Huub Lems, Mitglied der Protestantse Kerk in Nederland, einmal formuliert.
23 Bilder präsentiert das Museum auf der Hardt bis zu 23. Februar 2018: Aquarelle, Acryl auf Leinwand, Tuschezeichnungen, auch ein Batikbild ist darunter. Bunte, intensive Farben prägen das Werk Darsanes. Und der balinesische Tanz. „Er ist fester Bestandteil der Kultur auf Bali. Der Titel der Ausstellung „Das Wort wird Tanz“ heißt nichts anderes, als dass Christus auf Bali angekommen ist“, sagte Christian Sandner. Der Gemeindepfarrer in Rheydt, gewährte den Kunstinteressierten Einblicke in die Malerei Darsanes. Sandner war fast 14 Jahre lang beim Gemeindedienst für Mission und Ökumene und hatte 2009 im Rahmen einer Kontaktreise den Künstler in seinem Atelier auf Bali besucht. „Der balinesische Tanz, die Angklung-Musik und die Wayang-Figuren haben ihn geprägt“, meinte Sandner. Die Titel der Bilder stammen fast alle aus der biblisch-jüdischen Tradition. Etwa Jesus und die Ehebrecherin oder Jonah und der Wal. Immer wieder tauchen die beiden biblischen Schwestern, Maria und Martha, in seinen Bildern auf. Auch sie tanzen. Was faszinierte den Künstler an der Geschichte der beiden Frauen? Maria, zurückhaltend, die interessierte Zuhörerin und Gesprächspartnerin auf der einen Seite, und Martha, leidenschaftlich, ihre emsige und aktive Schwester, auf der anderen Seite. Doch anstatt den Gegensatz der beiden Charaktere im Bild festzuhalten, zeigt Darsane, was sie verbindet, dass sie zusammengehören. Diese Sehnsucht nach Harmonie ist typisch balinesisch. Sie spiegelt sich im Blick der beiden Schwestern wider. „Darsane stellt immer wieder Fragen zum Christentum wie beispielsweise diese: ‚Wer ist Jesus Christus?‘. Seine Antwort: Er zeichnet Christus als javanischen Christen“, sagte Christian Sandner. Nyoman Darsane möchte die in der Bevölkerung tief verwurzelte balinesische Kultur und Tradition nicht zerstören. Vielmehr möchte er durch die Begegnung und den Kontakt mit dem Christentum Fremdes angleichen und in das eigene Leben eingliedern und damit vielleicht eine neue Kultur schaffen.
Der Wuppertaler Musiker Andre Enthöfer begeisterte mit seinen Saxophon-Soloeinlagen das kunstinteressierte Publikum. Den Ökumeneschlager „Dalam Jesus kita bersaudera“ (In Jesus sind wir Geschwister) erkannte so mancher Museumsgast gleich nach den ersten Tönen des Holzblasintrumentes und der ein oder andere Fuß tippte im Takt den Klassiker der indonesischen Musik.
Die Bilder (50 x 30 cm bzw. 60 x 40 cm), können käuflich erworben werden.
Die Ausstellung ist vom 14. November 2017 bis zum 23. Februar 2018 im Museum auf der Hardt der Archiv- und Museumsstiftung der VEM (Missionsstraße 9, Wuppertal) zu sehen.
Öffnungszeiten für die Dauer der Sonderausstellung:
Donnerstag, Freitag und Sonntag von 11.00 – 17.00 Uhr
Dienstag von 13.00 – 16.00 Uhr
Einlass bis 30 Minuten vor Schließung
Eintritt: 4€/ermäßigt 3€ für die Dauer der Sonderausstellung
Eine wiederentdeckte Großmutter in der Mission, ein Chinese aus Hongkong, der dankbar ist, dass die Mission vor langer Zeit in seine Heimat kam. Diese und viele andere Geschichten mehr erzählten die Besucher am Stand der Archiv- und Museumsstiftung der VEM auf dem 6. Wuppertaler Geschichtsfest.
Bei bestem Wetter war der Platz am Bahnhof Loh, direkt an der Trasse, stets gut besucht. Viele Wuppertaler und Gäste interessierten sich für die Missionare und Missionarinnen und die Geschichte der Rheinischen Mission, die vor über 180 Jahren im Tal der Wupper ihren Anfang nahm.



Der Förderverein des Botanischen Gartens Wuppertal e.V. lädt am 19. und 20. August 2017 wieder ein zu einem Erlebniswochenende rund um den Elisenturm. Ab 11 Uhr können die Besucher an über 50 Festständen schauen und selbst aktiv werden.
Auch die Archiv- und Museumsstiftung der VEM gemeinsam mit der Vereinten Evangelischen Mission ist wieder aktiv am Samstag von 11-18 Uhr dabei. Informationen und Spiel erwarten Sie. Besuchen Sie uns am Stand Nummer 04 unweit des Elisenturmes.
Die Ausstellung „Der Luther-Effekt - 500 Jahre Protestantismus in der Welt“ ist seit Mitte April 2017 im Martin-Gropius-Bau in Berlin zu sehen. Sie ist eine von drei nationalen Sonderausstellungen zum 500. Reformationsjubiläum 2017, die unter dem Titel 3xhammer.de gezeigt werden. Die Schau zeigt exemplarisch anhand von vier Ländern (Schweden, USA, Südkorea und Tansania) die Geschichte und Entwicklung der Reformation in der Welt.
Ein kostenfreies Begleitheft zur Ausstellung führt den Besucher informativ durch die Ausstellung. Im Faltblatt des Veranstalters heißt es: „Das Deutsche Historische Museum präsentiert den „Luthereffekt“ im Martin-Gropius-Bau, Berlins internationalem Ausstellungshaus, mit rund 500 Exponaten. Darunter befinden sich herausragende Kunstwerke ebenso wie aussagekräftige Alltagsgegenstände. Viele dieser Objekte werden erstmals in Deutschland zu sehen sein.“
Unter den Objekten befinden sich auch einige Objekte aus den Beständen der Archiv- und Museumsstiftung der VEM. Insbesondere die Darstellung der Reformationsentwicklung in Tansania, dessen Abteilung den Untertitel Mission und Selbstbestimmung trägt, wird durch Objekte, Texte und Bilder aus dem Bestand der Stiftung präsentiert. Unter anderem sind dies eine große Makondekrippe und ein Lebensbaum, sowie historische Bilder aus der frühen Arbeit der Bethelmission und eine Halskette mit Kreuzanhänger der Maasai.
Die Ausstellung ist bis zum 5. November zu sehen. Anlässlich des Kirchentages in Berlin bietet das Museum allen Besucherinnen und Besuchern in diesen Tagen freien Eintritt zur Ausstellung.
Am Montag, den 3. April 2017 eröffnet die Ausstellung „Der geteilte Himmel – Reformation und religiöse Vielfalt an Rhein und Ruhr“ in der Zeche Zollverein im Ruhrmuseum in Essen. Die Ausstellung findet statt im Rahmen der „Refo 500 – connecting you. Then and now.“ Sie ist Teil der bundesweiten Kampagne „Am Anfang war das Wort. Luther 2017 – 500 Jahre Reformation” und thematisiert das Jubiläum als zentrale Ausstellung für das Land Nordrhein-Westfalen.
In zehn Kapiteln wird die 500-jährige Geschichte der Reformation an Rhein und Ruhr im Wandel der Zeit von den Anfängen bis in die Gegenwart erzählt. Dabei weitet sich der Fokus über den evangelischen Horizont hinaus und bezieht die Vielfalt religiöser Gemeinschaften in der Region ein. Die Auseinandersetzungen und Kompromisse mit der katholischen Kirche sind ebenso präsent wie die jüdische Glaubensgemeinschaft und die im Verlauf der Geschichte erst in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts hinzukommenden muslimischen und buddhistischen Gemeinden in der Region.
Im Faltblatt des Veranstalters heißt es zu der Ausstellungsgestaltung des Architekten Bernhard Denkinger: „Er entwickelte für die vielen religiösen Gemeinschaften einen gemeinsamen Himmel, der als Decke den industriellen Ausstellungsraum der Kohlenwäsche überspannt.“
Es werden über 800 Objekte von 250 Leihgebern gezeigt. Darunter befinden sich auch einige Objekte aus den Beständen der Archiv- und Museumsstiftung der VEM. So werden Gegenstände aus dem ‚heimatlichen‘ Kontext der Missionsarbeit in Deutschland zu sehen sein. Unter anderem sind dies ein historisches Quartettspiel, das die Missionsgebiete der Rheinischen Missionsgesellschaft vorstellt, sowie ein Werbeplakat für die Mission aus dem Jahr 1884.
Darüber hinaus werden jedoch auch ein rituell genutztes Buch der Batak aus Sumatra gezeigt sowie Gegenstände aus der Usambara Region in Tansania, die aus der Sammlung der Bethel Mission stammen.
Von Christoph Schwab
Sonderausstellung mit Arbeiten der namibischen Künstlerin Imke Rust wurde am 10.März 2017 eröffnet
Die Ausstellungseröffnung im Museum auf der Hardt der Archiv-und Museumsstiftung der VEM bildet den Auftakt des diesjährigen Länderseminars Namibia im Internationalen Evangelischen Tagungszentrum ‚Auf dem heiligen Berg‘.
Gezeigt werden unter Anderem fotografische Dokumentationen von Kunstprojekten der Künstlerin Imke Rust, die sie in der Wüste und an der Atlantikküste Namibias umgesetzt hat.
Die ökologische Situation in ihrem Land und die Auseinandersetzung mit den ökonomischen Begehrlichkeiten im Hinblick auf die Ressource Land sind zentrale Themen der Werke.
Imke Rust sucht nach Lösungswegen, wie die Menschen im heutigen Namibia die geerbte Vergangenheit verarbeiten und eine friedliche, lebenswerte Zukunft haben können. Als Nachfahrin deutscher Missionare in 5ter Generation in Namibia ist es aber auch ihr Anliegen, ihre eigene Position als weiße, deutschsprachige Afrikanerin und die Frage von Schuld und Vergebung zu reflektieren.
Objekte und historische Dokumente aus den Beständen der Archiv- und Museumsstiftung der VEM stellen dabei auch eine Verbindung zu der Familiengeschichte der Künstlerin her.
Ort: Museum auf der Hardt, Missionsstraße 9
Ausstellungseröffnung: 10.03.2017, 19 Uhr
Dauer der Ausstellung: 10.03. bis 04.04.2017, Di-Do 9 bis 15 Uhr nach vorheriger Anmeldung, Sa. 01.04. 14-17 Uhr
Das Städtische Museum Schloss Rheydt widmet sich unter dem Titel „Aufbruch in die Ferne - mit Gladbacher Reisenden durch die Jahrhunderte" der Historie des Reisens.
Ausgangspunkt der Ausstellung sind sechs Mönchengladbacher, ihre Motivation, ihre Ziele aber auch ihre Aktivitäten vor Ort. Hieran anknüpfend werden die Veränderungen und Entwicklungen des Unterwegsseins vom Mittelalter bis zur Neuzeit aufgezeigt. Als einschneidendes Ereignis in der Geschichte der Mobilität gilt dabei die technische Entwicklung der Eisenbahn im 19. Jahrhundert, mit der Reisen schneller und komfortabler wurde. Ein gesonderter Ausstellungsbereich wird sich unter dem Titel „Komfort auf Schienen - mit Luxuszügen durch Europa" dem Phänomen der Komfortreise widmen und die Fahrt im Luxuszug um 1900 beleuchten.
Souvenirs und Postkarten erinnern schließlich an das Glück in der Ferne. Sie führen den Besucher zurück in die heimatlichen Gefilde und beleuchten die Andenkenvielfalt, die von touristischen Objekten bis zu kulturellen Erinnerungsstücken reicht.
Die Archiv –und Museumsstiftung der VEM unterstützt mit der Leihgabe von Bild- und Schriftmaterialien die Ausstellung.
Laufzeit der Ausstellung: 12.März-30. Juli 2017
Ankündigung "Stolen Moments - Namibian Music History Untold"
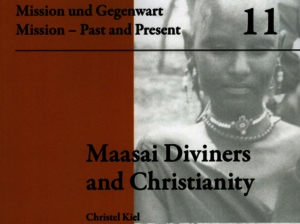
Autorin: Christel Kiel. Reihe herausgegeben von: Archiv und Museumsstiftung der VEM, Wuppertal.
Die verschiedenen ansässigen Heiler und Wahrsager der Maa-sprechenden Gesellschaften des östlichen Afrikas sind unter dem Namen llÓibonok bekannt. Als Vermittler zwischen den Welten wird ihnen Hochachtung und Ehrfurcht, gleichzeitig aber auch Angst entgegengebracht. Sie waren stets Fremde und Außenseiter innerhalb der Gemeinschaft, sowohl durch ihre Abstammungslinie als auch aufgrund ihrer Tätigkeit, und in den Anfangszeiten der Missionierung sahen die Missionare in ihnen Zauberer und von Dämonen besessene, die das Evangelium von den Maasai fernhielten oder die Maasai vom Evangelium.
Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts hatten sie einen durchaus ernstzunehmenden, wenn auch langsam schwindenden Einfluss auf die Gesellschaft. Wie sahen die Vertreter der Lutherischen Kirche die llÓibonok? Und wie schätzten die Heiler das Christentum ein, nachdem sich herausgestellt hatte, dass die fremde Religion nicht nur eine vorübergehende Modeerscheinung war? Dies sind die zentralen Fragestellungen des vorliegenden Werks.
Das Interesse der Autorin, zu Maasai-Wahrsagern und ihrer Beziehung zur christlichen Kirche zu forschen, wurde geweckt, als sie zur Geschichte der Maasai-Missionen in der nord-östlichen Diözese der Lutherischen Kirche von Tansania arbeitete. Dabei stellte sie fest, dass das Verhältnis zwischen Kirche und Wahrsagern bislang nicht überprüft worden war, obwohl von christlichen Pastoren erwartet wurde einige der Aufgabenfelder, die vor dem Aufkommen des Christentums traditionell von den llÓibonok ausgeübt wurden, zu übernehmen.
Der erste Teil dieser Arbeit befasst sich mit den in Tansania ansässigen llÓibonok, der Arbeit die sie bis 1999 geleistet haben und den Mitgliedern des Tilián-Klans, welche die Autorin persönlich getroffen hat. Im zweiten Teil wird ein allgemeiner Überblick über die Arbeit der damals praktizierenden Wahrsager und Heiler präsentiert. Teil 3 beleuchtet die Umstände und Begebenheiten des Zusammentreffens von Missionaren und Wahrsagern und versucht einen Eindruck von der Einstellung der Christen des 20. Jahrhunderts zu den llÓibonok zu vermitteln. In einem abschließenden Kapitel versucht die Autorin, auf der Bibel basierende Kriterien für eine funktionierende Beziehung und mögliche Zusammenarbeit der in bestimmten Gemeinden praktizierenden Christen und Wahrsager herauszuarbeiten.
Zur Kultur und Sprache der Maasai ist in unserem Programm eine umfassende annotierte Bibliographie erschienen:
2015
12 Seiten römisch, 146 Seiten,
1 Karte, 10 Farbfotos, 2 s/w Fotos, Glossar
Textsprache(n): Englisch
Format: 160 x 240 mm, 380 g, Broschur, €29,80
Begleitmaterial: A Bibliography of the Maa Language and the Maasai People (ISBN 978-3-89645-710-3)
Es handelt sich hier um eine farbenfroh bemalte Becak aus Indonesien. In Deutschland sind solche durch Muskelkraft betriebene und in ganz Süd- und Südostasien eingesetzte Personentransporter in der Regel besser bekannt unter ihrem indischen Namen (Fahrrad-) Rikscha. Das Dreirad-Prinzip einer wahlweise hinter dem Sattel oder vor dem Lenker des Fahrers angebrachten Sitzbank für ein bis zwei Fahrgäste ist jedoch bei allen Fahrzeugen dieser Art gleich.
Auch in Indonesien gehören die Becaks zum Alltag, werden aber vor allem in den größeren Städten mehr und mehr von motorgetriebenen Fahrzeugen verdrängt. In Metropolen wie der Hauptstadt Jakarta sind sie schon lange aus dem Straßenbild verschwunden. In kleineren Orten und auf dem Land findet man sie jedoch nach wie vor häufig im Einsatz.
Diese Becak ist mit ihren ca. 15 Jahren ein vergleichsweise junges Objekt in der Sammlung. Sie wurde von Doris und Michael Brandt, zwei langjährigen Mitarbeitern im Dienste der Mission, in Solo auf der Insel Java erworben, verbrachte später einige Zeit in Wuppertal und Herne, bis sich das Ehepaar schließlich entschloss, sie an die Archiv- und Museumsstiftung der VEM zu übergeben. Insofern wurde mit dem Gefährt trotz seines jugendlichen Alters und Erscheinungsbildes auch schon ein kleines Stück Missionsgeschichte geschrieben.
Sommerliche Ausfahrten wird es mit der Becak aus technischen Gründen allerdings nicht mehr geben. In den Räumen des Museums auf der Hardt wird sie aber in Zukunft dauerhaft zu sehen sein und einen Eindruck vom Leben auf den Straßen Indonesiens vermitteln.
Museum auf der Hardt
Besucheradresse:
Missionsstraße 9
42285 Wuppertal
Tel: 0202-89004-152
Postadresse:
Rudolfstraße 137
42285 Wuppertal
Öffnungszeiten Museum auf der Hardt
Jeden 1. Sonntag im Monat 14.00 – 17.00 Uhr und auf Anfrage
Einlass bis 30 Minuten vor Schließung
Weitere Besuchsmöglichkeiten nach Anmeldung
Eintritt: 3€/ermäßigt 2€


IBAN: DE45 3506 0190 0009 0909 08
SWIFT/BIC: GENODED1DKD
spenden@vemission.org
0202-89004-195
info@vemission.org
0202-89004-0
presse@vemission.org
0202-89004-135
CRDB BANK PLC / Branch 3319
Account# 0250299692300
Swift code: CORUTZTZ
Bank BNI
Account# 0128002447
Swift code: BNINIDJAMDN
info@vemission.org
presse@vemission.org